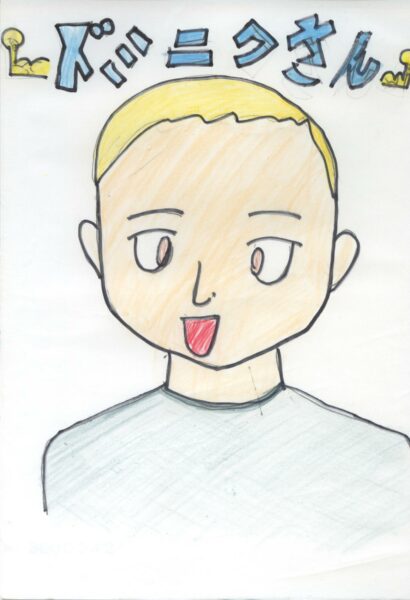Mittwoch, 31.12.2003 – Wofür ein Schrein nicht alles gut sein kann…
Entsprechend der Zeit, zu der ich schlafen gegangen bin, wache ich spät auf. Aber viel haben wir ja nicht vor. Wir gehen noch einkaufen und wollen auch noch Post loswerden, aber die Post hat bereits ab heute geschlossen – bis zum 04. Januar. Die Supermärkte, wie auch der 100-Yen Laden, haben allerdings geöffnet, wenn auch nicht so lange wie gewöhnlich. Und wenn ich schon da bin, kann ich auch gleich die Schriftzeichen an der Tür unseres BenyMarts entschlüsseln. Darauf ist zu lesen, dass morgen, am 01. Januar, der Laden in der Tat dicht bleiben wird. Aber am 02. Januar hat er bereits wieder geöffnet, mit der Einschränkung, dass erst ab zehn Uhr am Morgen offen sein wird – entgegen Volkers Warnung, dass an den ersten drei Tagen im Jahr tote Hose sein würde. Mein Gott, hat sich das seit dem letzten Jahr denn so radikal geändert, oder gönnt man sich in Tokyo mehr Urlaubstage als hier draußen auf dem Land?[1] Ich vervollständige dennoch meinen Getränkevorrat, und Sushi möchte ich auch nicht vermissen wollen. Aber die Platten, die da heute wegen des Feiertages verkauft werden, kosten kurzerhand 4000 Yen (ca. 30 E) und die nehme ich nicht einmal zum halben Preis. Das Preis-Leistungsverhältnis ist mir dann doch zu mies.
Zuhause wartet trotz unserer Waschbemühungen noch immer eine große Menge Wäsche auf uns. Wird das denn nie weniger? Um 18:00 kommt ein Doraemon Special, und es handelt sich um die lange Episode, in der Doraemon ins 22. Jahrhundert zurückkehren muss und wo Nobita sich als nahezu unfähig herausstellt, ohne seinen „Katerbot“ auszukommen. Leider kann ich mir das Special nicht ganz ansehen, da um 19:30 die alljährliche „Kohaku“ Sendung beginnt. Diese Show hat den Zweck, die erfolgreichsten Musiker des Jahres zu präsentieren, und zwar aus allen in Japan gängigen Sparten musikalischer Unterhaltung. Untermalt wird das Ganze von kleinen Showeinlagen. Diese Sendung reizt mich allerdings mehr zum Gähnen als zum Zusehen, also muss ich mir das wirklich nicht ansehen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Ich kam in Trier bereits in den zweifelhaften Genuss, eine der Sendungen als Bandaufzeichnung zu sehen.
Meine Güte, ist das langweilig! Man stelle sich die ZDF Hitparade mit Dieter Thomas Heck gemeinsam mit der Goldenen Hitparade der deutschen Volksmusik mit Marianne und Michael als Koproduktion vor. Ja, gleichzeitig. Die Hälfte der Interpreten sind gewöhnlich Enka-Sänger, und bei Enka handelt es sich um… nennen wir es das japanische Äquivalent zur deutschen Volksmusik. Die Lieder sind sehr emotional, zum Teil schmalzig bis jammervoll, handeln von verlorener Liebe oder ferner Heimat (oder von beidem gleichzeitig) und angesichts des eigenen Textes brechen die SängerInnen auch schon mal gerne in Tränen aus. Das heißt, Volksmusik ist vielleicht der falsche Ausdruck. Wenn ich einem Deutschen gegenüber von „Volksmusik“ spreche, assoziiert er oder sie das mit Musikanten, die in ländliche Trachten gekleidet sind, und mit eher bierseliger Atmosphäre, Schunkeln und so. Vielleicht sollte man Enka besser beschreiben als eine Art von Musik, bei der die Texte zwar sentimental-volkstümlich sind, deren Aufmachung aber eher dem Sammelbegriff „Schlagermusik“ gerecht wird.[2]
Subjektiv von meiner Position aus betrachtet ist es aber auch eine Art von Musik, von der ich Zahnschmerzen bekomme. Ich bleibe lieber bei meinem „Krach“. Jedem das seine. Denn die Enka-Interpreten sind sehr erfolgreiche und zum Teil steinreiche Musiker, die ein Publikum ansprechen, das Geld hat. Leute ab Mitte 40, möchte ich annehmen. Für eine Eintrittskarte in ein Live-Konzert bezahlt man ein kleines Vermögen – selbst wenn man sich mit drittklassigen Sitzplätzen zufriedengibt. Ich habe mir den genauen Preis aus einer der Werbesendungen nicht herausgeschrieben, aber es handelt sich um einen Gegenwert von mehreren Hundert Euro. Für einen drittklassigen Sitz.
Der Rest des Programms besteht aus dem bunten Haufen des japanischen Einheitsbreis, sei es Pop, Rap, HipHop, Rock, oder was man sonst noch so kennt. Für zwei Lieder, die mir möglicherweise gefallen könnten, sehe ich mir doch keine Sendung von vier Stunden an, die allgemein eher einschläfernd wirkt. Ich lege mich um 20:30 aufs Ohr.
Melanie weckt mich um 22:30 wieder, um zum Tempel zu gehen. Wir gehen um etwa 22:50 aus dem Haus, und wir wollen uns Zeit lassen, nur nicht hetzen. Wir gehen zu Fuß, weil wir nicht sicher sein können, dass die Straße nach Mitternacht noch eisfrei sein wird. Wir erreichen den Tempel gegen 23:30 und treffen dort bereits mehrere Hundert Anwohner der Stadt an, die in einer langen und breiten Schlange vor dem Tempel stehen. Der zwei Meter breite Weg ist voll und daneben ist es ebenfalls ziemlich eng. Am Eingang zum Allerheiligsten hängt eine kleine Glocke, die man läutet, und dann kann man kurz beten, wenn man das will. Und damit die Leute in der Schlange sich nicht langweilen, hängt neben dem Eingang ein Flachbildfernseher, der Landschafts- und Wetteraufnahmen zeigt.
Wir laufen dort David und Arpi über den Weg. Ansonsten bemerken wir niemanden, den wir kennen. Das einzige uns bekannte japanische Gesicht ist Kazu (aber die kommt erst später an die Reihe). Wir sehen uns um und finden ein nicht zu verachtendes Nahrungsangebot in den typischen kleinen Buden vor. Ich esse Takoyaki, das sind Tintenfischstücke in einem Teigmantel, und das zu einem horrenden Preis. Ansonsten gibt es Fleischspieße, „Frankfurter Würstchen“ am Stiel, Bananen mit Schoko-, Erdbeer- oder Melonenglasur, und noch einige Dinge mehr, die ich wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Ja, natürlich wird auch Sake ausgeschenkt. Aber mir ist nicht danach. Auch das hängt mit den Preisen zusammen. 450 Yen pro Glas sind mir zu viel des Guten, Feiertag hin oder her.
Das Läuten der Hauptglocke beginnt um kurz vor Mitternacht. Unter der großen Glocke wird ein kleiner Holzstapel abgebrannt. Vor der Glocke steht der Priester und rezitiert eine Art Gebet. Dann nimmt er einen Stock, an dem weiße Papierbänder befestigt sind und geht damit einmal um die Glocke herum. Dann schlägt er die Glocke dreimal mit dem etwa armdicken Holzschwengel, der an dem Gerüst um die Glocke befestigt ist.
Vor diesem Konstrukt steht eine große Menschenmenge, die nicht einfach nur Zuschauer sind. Die Leute halten nummerierte Zettel in der Hand, und als der Priester die Szene wieder verlässt, rufen seine Gehilfen Nummern auf. Die aufgerufenen Leute gehen zur Glocke und läuten sie. Die meisten machen das einmal. Andere schlagen den Schwengel gleich zwei- oder dreimal an die Glocke. Ich bin nicht ganz sicher, wie das System funktioniert. Ich dachte eigentlich, dass die Glocke 108-mal geschlagen würde, stellvertretend für die Anzahl der Sünden, die der Buddhismus offenbar kennt. Aber ich bin sicher, dass die Glocke heute Nacht öfter geläutet wird. Es heißt, jeder schlage die Glocke entsprechend der Arten von Sünden, die er oder sie begangen hat. Also quasi Beichte und Absolution in einem, ohne dass ein Wort gesagt werden muss. Und einige Jugendliche machen sich auch mehr einen Spaß aus der Angelegenheit und fotografieren sich in reißerischen und wenig feierlichen Posen vor oder an der Glocke.
An anderer Stelle stehen Jugendliche um ein Feuer herum, in dem alles Mögliche verbrannt wird, nicht nur das dafür vorgesehene Holz. Alle Müllerziehung scheint völlig an den Beteiligten vorübergegangen zu sein, und die „Täter“ sind nicht nur Jugendliche. Da wird alles ins Feuer geworfen, was gerade störend erscheint, Neujahrsschmuck und Plastikmüll gleichermaßen. Und wenn die Flammen am schönsten sind, springen manche der Jungs in das Feuer und tanzen einige Sekunden darin herum. Man merkt direkt, dass sie was getrunken haben und ihre Klamotten vermutlich nicht selbst bezahlt haben. Neben dieser Art von Mutprobe pöbeln sie auch noch die anwesenden Polizisten an, die aus mir völlig unersichtlichen Gründen dabeistehen. Sie hindern niemanden daran, Plastikmüll von den Verkaufsständen zu verbrennen, lassen die Jungen im Feuer rumhüpfen und reagieren auf antiautoritäre Handlungen auch noch mit einer stoischen Gelassenheit, die mich doch erstaunt.
Dieses Schauspiel fesselt mich letztendlich allerdings wenig und ich gehe mit Melanie vom Tempel zum angrenzenden Yasaka-Schrein hinüber, vorbei an Steinfiguren von buddhistischen Gottheiten, denen offenbar auch „Hello Kitty“ Luftballons geopfert werden können. Vor dem Schrein befindet sich ebenfalls eine lange Schlange von Menschen, wenn auch nicht ganz so groß wie vor dem Tempel. Das könnte natürlich daran liegen, dass weniger Platz vorhanden ist. Der Weg ist nur zwei Meter breit, aber ausgefüllt, und die Warteschlange ist etwa 75 Meter lang. Auch hier will man das erste Gebet des Jahres sprechen, kurz nach Mitternacht. Dazu rüttelt man an dem dicken Seil aus Reisstroh, das vom Tempeldach herunterhängt und mit dem man die daran befestigte Rassel tönen lässt. Es handelt sich nicht um eine Glocke, sondern um einen hohlen Metallball, in dem Metallkugeln eingeschlossen sind. Man rüttelt am Seil und es rasselt. Die Aufmerksamkeit der Götter muss ja irgendwie erregt werden. Dann klatscht man zweimal in die Hände (zumindest haben das die Leute gemacht, die ich beobachten konnte) und spricht sein wie auch immer geartetes Gebet, inklusive guter Vorsätze und irgendwelcher Wünsche. Soweit mir bekannt, bedarf es dazu keiner besonderen Formel. Dann wirft man eine Münze in den obligatorischen Opferkasten, und wie in Tokyo handelt es sich auch hier zum größten Teil um 1- bis 10-Yen-Muenzen. Nur selten sehe ich eine silberfarbene Münze (50 Yen oder mehr) durch die Gegend fliegen.
Auf der Veranda des Schreins sitzt oder kniet ein älterer Herr, der eine Mandarinenkiste nach der anderen an die Besucher verteilt. Das heißt, er verteilt natürlich keine Kisten, sondern deren Inhalt, und gibt jedem, der an ihm vorbeigeht, eine oder zwei Mandarinen, je nach Größe der Mandarinen oder je nach Person. Ich komme nicht dazu, repräsentativ festzustellen, ob z.B. Frauen durchschnittlich mehr Mandarinen erhalten, als die Männer. Ich stehe zwei Meter vor dem Schrein auf einem Schneehaufen wie Napoleon auf seinem Feldherrenhügel bei Austerlitz und betrachte die Szene ruhig. Dann sieht mich der Mandarinenverteiler an und winkt mich zu sich her. Ich gehe zu ihm hin und frage, was denn sein Begehr sei.
„Es ist doch bestimmt kalt da draußen, oder?“ fragt er.
„Hm, ja, es ist in der Tat ein wenig kalt.“
„Ja dann kommt doch rein und feiert ein bisschen mit uns!“
„Einfach so – in den Schrein?“
„Ja, natürlich. Jeder darf rein. Wir trinken und essen im Schrein.“
Hm, ja, vor allem „trinken“, habe ich den Eindruck. Ich winke also Melanie her und mache ihr das Angebot klar. Kurz darauf sitzen wir im Inneren des Schreins, bekommen Tassen und werden mit Sake versorgt, ebenso mit allerlei köstlichen Happen, kalt zwar, aber unheimlich gut. Ich sitze also im Yasaka Schrein zu Hirosaki, esse Hühnchen, Gemüse-Tempura und Ebi-Tempura (frittiertes Gemüse und Garnelenschwänze), sowie Maguro Sashimi (eine Art von rotem Fisch, in Streifen geschnitten, natürlich roh mit Sojasoße) und trinke einen Becher Sake nach dem anderen, weil er „auf wundersame Weise“ nicht leer werden will. Ich bekomme auch eine Kostprobe süßen Sake. Er hat einen sehr angenehmen Geschmack, der mich ein wenig an lieblichen Weißwein erinnert. Es ist für mich immer noch arg seltsam, den Sake kalt zu trinken, aber mit dem, was man mir hier kredenzt, kann man das tatsächlich machen – nicht wie das Zeug von Choya, das man in Deutschland als Sake-Liebhaber trinken muss.[3]
Der Raum hat eine Größe von etwa vier mal fünf Metern, und darin befinden sich etwa ein Dutzend Leute: Vier oder fünf ältere Herren, alle reichlich angetrunken, dann noch drei oder vier Männer von maximal 40 Jahren, ein Ehepaar und drei Kinder. Es werde gefeiert bis zum Morgen, sagt unser linker Sitznachbar, ein ergrauter Herr, pensionierter Elektroingenieur, wie er später noch hinzufügt. Sake sei genug da, hebt er noch hervor. In der Tat stehen in der Ecke noch mehrere Pappkisten, in denen sich jeweils sechs Flaschen mit jeweils 1,8 Litern Inhalt befinden. Ich schätze, dass da drüben noch mindestens 44 Liter astreiner japanischer Sake herumstehen. Und eine Handvoll Flaschen kursiert geöffnet im Raum. Der Sake hat einen Geschmack, dass man sich an ihm tot trinken möchte. Na ja, nicht ernsthaft. Aber gut ist er auf jeden Fall.
Man zeigt sich erfreut, dass wir Deutsche sind, beschwert sich über die aktuelle Außenpolitik der USA und über den Schmusekurs der japanischen Regierung (der Ingenieur nennt die Amerikaner bevorzugt „Yankees“, schimpft auf den Krieg im Irak und meint, Hiroshima und Nagasaki hätten ihm gereicht), verwendet deutsche Floskeln wie „Guten Abend“, „Auf Wiedersehen“ und „Ich liebe Dich“ und schlägt nebenher hin und wieder die kleine Taikotrommel, während es von außen lustig weiter Geld ins Innere des Schreins regnet. Während der Zeit, in der ich im Schrein sitze, rollen mehrere Münzen, die die Opferkiste verfehlen, zu mir herüber, und einmal ist sogar eine 50 Yen Münze darunter. Ansonsten nur geringeres Kleingeld.
Um 01:00 fühle ich mich ziemlich angeheitert und Melanie, die es bei einer höflichen Probierportion belassen hat, mahnt mich dazu an, die Gastfreundschaft nicht zu sehr zu strapazieren. Um 01:30 gehen wir dann tatsächlich. Und weil ich die ganze Zeit im ungewohnten Schneidersitz auf dem Boden gesessen habe, stehe ich auf wie ein alter Mann und ernte dafür natürlich das Gelächter der echten alten Männer. Mein rechter Nachbar lässt es sich nicht nehmen, meine Beine mit lockeren Handkantenschlägen zu massieren, damit wieder etwas Leben hineinkomme und ich wieder gehfähig werde. Das ist mir natürlich peinlich, aber er scheint einen ungeheuren Spaß daran zu haben. Wir bedanken uns für alles und verlassen den Schrein wieder.
Und zehn Meter weiter treffen wir Kazu und ihre Familie, die zum Neujahrsgebet hergekommen sind. Das heißt, ich erkenne ihr Gesicht, aber in meinem derzeitigen Zustand kann ich mich an ihren Namen nicht mehr erinnern. Sie frischt mein Gedächtnis auf und stellt mir ihre Mutter, ihren Onkel und dessen Ehefrau vor. Ich frage, wo denn der Vater abgeblieben sei, und sie sagt, den gebe es nicht (was auch immer das bedeutet), und Melanie bedeutet mir, das Thema unter den Tisch fallen zu lassen. Und das ist auch nicht weiter schwer. Kazus Mutter ist offenbar erfreut, ihre Englischkenntnisse zum Besten geben zu können, wird aber von ihrer Tochter unterbrochen, in der Art „Mama, mach mich bitte nicht lächerlich hier!“
Ja, und die Gattin des Onkels hat es auch in sich. Ich würde sie als (auf durchaus positive Art und Weise) „frech“ nennen. Sie fährt sich mit der Hand durch ihre langen, dunkelblond gefärbten Haare und fragt mich „Bin ich nicht hübsch, hm?“ Ich bin etwas perplex angesichts dieser unvermuteten Frage, und sage „Ja, das sind Sie wirklich. Aber Sie scheinen mir auch ein wenig seltsam zu sein…“ Darauf zieht sie einen Schmollmund und meint „Das ist aber unhöflich!“ Ich bekomme das Adjektiv „hidoi“ als Umschreibung meines Verhaltens oft zu hören und japanische Damen geizen auch nicht mit dem Gebrauch. Aber bislang nur bei Gelegenheiten, wo es nicht ernst gemeint ist. Ich glaube, wenn ich Leuten durch meinen Mangel an Kultur auf die Füße trete, halten die lieber den Mund, anstatt sich zu beschweren. Ich bekomme immer nur Hinweise durch die Hintertür, und das auch nur von dritten (oder vierten) Personen. Also z.B. von „vierten“ Leuten, denen „Dritte“, Beobachter meiner Unhöflichkeit gegenüber einer „zweiten“ Person, eine solche vorgetragen haben. Ich muss besser auf meine Sprache achten.[4]
Wir verabschieden uns von der Familie und gehen Richtung Ausgang, nur um wieder umzukehren, weil ich meinen Schal im Schrein habe liegen lassen. Aber der wird binnen drei Sekunden gefunden und ich habe dann wohl alles wieder beisammen, mit Ausnahme meiner Sinne, die noch recht vernebelt sind.
Die Temperatur ist nicht weiter gefallen und die Straßen sind eisfrei. Auf den Bürgersteigen hält sich zwar immer noch Restschnee, aber wenn die Temperaturen nicht winterlicher werden, wird der Schnee auch bald verschwinden.
[1] Mein Kamerad Volker hatte aber in erster Linie die Schließung der Geldautomaten beklagt, wovon ich mangels Bedarf nichts merkte.
[2] In der Tat beruht Enka auf Protestliedern der Liberal-Demokratischen Partei Japans aus der Zeit der politischen Repression vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
[3] Streng genommen muss man dies nicht, aber man müsste idealerweise nach Düsseldorf fahre, um eine gute Flasche zu bekommen; wenn man das Angebot kennt, kann man natürlich heutzutage den Onlinehandel bemühen.
[4] Jener Onkel verstarb 18 oder 19 Jahre später ganz unerwartet, was mich überraschend traurig stimmte, denn an den Herrn kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich verspürte aber starkes Mitgefühl für die liebenswürdige Dame, die mich bei unserer kurzen Begegnung doch nachhaltig beeindruckt hatte.