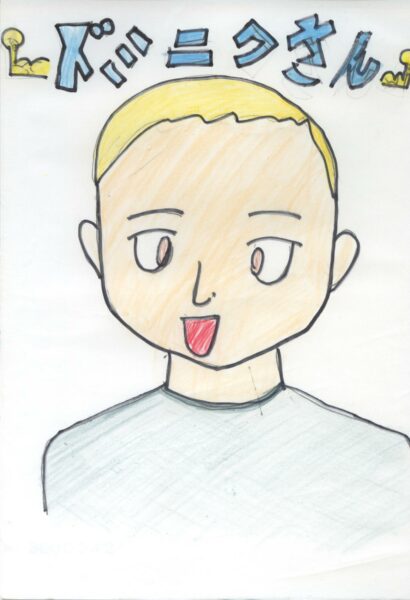Heute Morgen ist es zum Teil recht windig und einzelne Schneeflocken fallen vom Himmel. Es sind kleine Schneeflocken – aber es sind Schneeflocken. Es ist dem entsprechend kühl.
Die heutige Episode SailorMoon verläuft ohne große Überraschungen. Makoto und Rei streiten sich, Rei wird von Mitarbeitern ihres Vaters (der ein reicher, mächtiger, und vor allem obskurer Politiker ist) gewissermaßen aus dem Schrein ihres Großvaters entführt. Makoto rettet sie (die Wachen fliegen nur so in der Gegend rum) und alles ist wieder gut. Interessant fand ich die Jupiter-Attacke „Flower Hurricane“. Davon habe ich noch nie gehört… oder habe ich die vergessen? Mir deucht, da will jemand kreativ anstatt reproduktiv sein.
Reis Vater oder Großvater bekommt man nicht zu Gesicht. Von dem Schrein hat man allgemein noch so richtig nichts außer ein paar nichts sagenden Außenaufnahmen gesehen. Ich will auch betonen, dass der „Hikawa Jinja“ kein Tempel (= buddhistisch), sondern eben ein Schrein (= shintoistisch) ist. Und bislang fehlt da noch ein wichtiger Jemand: Yûichirô, der Schreindiener aus Leidenschaft. Ich würde sein Fehlen wirklich sehr bedauern. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Annäherung von Makoto und Motoki muss ich allerdings fürchten, dass hier die „Beinahe-Beziehung“ Yûichirô/Rei der Animeserie aus Gründen der „Kreativität“ durch die neue Konstellation ersetzt wird.
Abgesehen davon finde ich es ein wenig dämlich, dass die Truppe sich die meiste Zeit in einem der (Karaoke) Räume des „Crown Game Center“ trifft, anstatt im Schrein. Okay, Luna hat den Mädels auf geheimnisvolle Art und Weise Dauerkarten für kostenlosen Zutritt verschafft, aber das wirkt an den Haaren herbeigezogen, und es ist nicht das gleiche, die Stimmung ist total anders, weil der Karaoke Raum widerlich künstlich aussieht, im Gegensatz zu der gediegenen Atmosphäre eines Schreins. Aber selbst wenn die fünf Freundinnen die Raummiete im Game Center zahlen müssten, würde das wohl nicht so sehr ins Gewicht fallen, wie man meinen könnte… am Tisch sitzen ja Usagi, Ami, Rei und Makoto, und schließlich wird noch Minako dazukommen – und von den fünf genannten Personen haben zumindest vier keinerlei finanzielle Sorgen. Bis auf Usagi sind die alle „wohlhabend“ bis „reich“: Minako als gefeierter Star, Rei mit dem Vater im Hintergrund, Ami mit der Ärztin als Mutter (und dem Vater, der es sich offenbar leisten kann, lieber irgendwo in der Welt herumzureisen und Bilder zu malen, als Zeit mit seiner Tochter zu verbringen), und Makoto mit ihrer (zumindest mutmaßlichen) Waisenrente, die ihr eine geräumige Wohnung in Tokyo für sich allein erlaubt!
Venus ist noch nicht dazugekommen. Wenn sie in der kommenden Episode nicht dazustößt, steht fest, dass hier unnötig Zeit und Produktionskapital verschwendet wird – man könnte sich doch auf das Wesentliche beschränken, als ständig nur „Das Monster der Woche“ zu präsentieren. Mehr Storyentfaltung statt Leerlauf! Ich komme zu der Überzeugung, dass die derzeitige Produktion sich auf die erste Staffel beschränken wird. Natürlich mag jetzt jemand einwenden, „auf dieser und jener Seite im Internet sind die Fakten doch zu finden, warum nur vermuten?“, aber ich muss sagen, dass ich mir nicht die Mühe mache, selbst groß zu suchen. Ich weiß inzwischen, was mich interessiert. Ich weiß, dass es eine „Episode 0“ gibt (ein „Making Of“), ich kenne die Namen der Hauptdarstellerinnen auswendig, nachdem ich sie zweimal angesehen habe (wenn mir doch nur alles so gut merken könnte, wie die Namen hübscher Frauen!) und ich habe mir die Geburtsdaten der Mädels mal angesehen – die Hauptdarstellerinnen sind zwischen 1986 und 1988 geboren, also durchaus passend für diese Rollen.
Ein Blick auf meine finanzielle Entwicklung: Am Ende des Monats scheint mir exakt so viel Geld übrig zu bleiben, wie der Anteil Melanies an den Gesamtkosten wert ist – wäre ich alleine hier, hätte ich also gerade genug zum Überleben und ab und zu einen Keks als Sonderration an Sonntagen… Ich empfehle allen meinen Nachfolgern, sich eine Wohnung mit jemandem zu teilen. Wenn man das nicht will und wenn auch nicht übermäßig viel Platz braucht, sollte man keine zwei Zimmer nehmen – eine Einzimmerwohnung reicht voll und ganz aus, und spart ein paar Tausend Yen Miete. Melanie und ich verwenden unser Tatamizimmer z.B. nur als Schlafzimmer und für sonst nichts. Rein materiell betrachtet kämen wir auch mit einem einzigen Raum aus. Der einzige konkrete Vorteil des zweiten Raumes ist der zweite Schrank, der sich darin befindet. Müssten wir die Futons zusammen mit den anderen Sachen in einem einzigen Schrank unterbringen, hätten wir ein Platzproblem. Andererseits wird die eine oder andere Ecke auch noch nicht wirklich effektiv ausgenutzt, wie z.B. das kleine Schrankfach über dem Hauptschrank. Wenn man die ganzen Kartons wegwirft, könnte man da noch einiges hineintun.
Aber was hilft das Klagen (eigentlich will ich mich gar nicht beschweren!), es ist so, wie es ist. Und der wahre Vorteil eines zweiten Raumes ist die Rückzugsmöglichkeit, die er bietet. Andauernd auf Tuchfühlung zusammen zu sein, führt zwangsweise zu Spannungen, die ich zur Erhaltung meiner Beziehung eigentlich vermeiden möchte.
Übrigens muss man nicht gleich verzweifeln, nur weil man zuhause niemanden findet, mit dem man zusammenwohnen möchte oder kann, weil man vielleicht der einzige von seiner Heimatuni ist, der hierher kommt. Es gibt hier genügend Möglichkeiten. Misi hat anfangs ebenfalls nach jemandem für eine 2er-WG gesucht (aber niemanden gefunden, ähem…), aber Mei z.B. hat eine weitere Chinesin gefunden, BiRei, die bereit war, mit ihr eine Wohnung zu teilen. Und mir scheint, die kommen gut miteinander aus.
Aus Tokyo höre ich, dass es dort kaum (oder keine?) „Internationale Feste“ gebe. Wie soll ich diese Meldung interpretieren? Was soll ich denn in Tokyo, wenn die ach so guten Universitäten dort es nicht für notwendig (oder erschwinglich) betrachten, den kulturellen Austausch etwas in Gang zu bringen? Ich finde das reichlich traurig. Dann wundert mich wenig, dass sich unter den vertretenen Ethnien „geschlossene Gesellschaften“ bilden. Wohl dem, der genügend Landsleute zur Auswahl hat! Wenn man mit einzelnen Exemplaren nicht zurecht kommt, kann man sich auch an andere wenden. Wenn man dagegen einen kurzen Strohhalm gezogen hat, vielleicht der einzige aus seinem Heimatland ist oder mit seinen Landsleuten nicht zurechtkommt, dann hat man verloren. Es ist nicht jedermanns Sache, von sich aus auf fremde Leute zuzugehen, um Kontakte zu knüpfen. Und wenn das nicht gelingt oder unterlassen wird, könnte das Austauschjahr eine widerlich einsame und lange Zeit werden.
Ich bin der Meinung, dass die Universitäten den Studierenden unter die Arme greifen sollten, damit diese irgendwo sozialen Anschluss finden. Und das nicht nur bei Japanern, sondern auch untereinander. Wann erhält man schon eine Gelegenheit, sich unter einen derart internationalen Haufen zu mischen? Ich habe das Gefühl, dass die vertretenen Nationen hier interessanter (weil für mich exotischer) sind, als das, was sich z.B. in Trier tummelt (obwohl dort die gleichen vertreten sind). Aber das ist nur meine persönliche, subjektive Meinung. Vielleicht bedarf es dafür einer „anleitenden“ Institution. Und das hiesige Ryûgakusei Center erfüllt diese Aufgabe sehr vorbildlich.
Wenn man eine zurückgezogene Natur ist, die nicht von alleine Kontakte sucht (aber dennoch braucht), muss man doch in Tokyo vereinsamen – oder sehe ich das falsch? Ich persönlich komme damit zurecht, nur oberflächliche Kontakte zu haben, weil ich mich auch mit mir selbst genug beschäftigen kann – aber ich bin ja auch „Der Extreme“. Wer also mehr Wert auf soziale Kontakte legt, als auf die – wie soll ich sagen? – infrastrukturellen Vorteile der Megalopole Tokyo, der komme ruhig nach Hirosaki. Ich habe es bisher in keiner Weise bereut.
Aber der Winter kommt ja erst noch.
Um zehn Uhr am Morgen kommt SangSu die Treppe hoch und klingelt an meiner Tür – um mir zu sagen, dass es schneit. Ich bin erst ein wenig verwirrt, weil er wegen dieses banalen Umstandes extra vorbeikommt, aber ich empfinde es als eine freundschaftliche Geste. Bei der Gelegenheit kläre ich ihn darüber auf, dass ich kein „-san“, sondern ein „-kun“ bin. Wenn ich irgendwann einmal reich und wichtig sein sollte, darf er mich gerne „Dominik-san“ nennen, aber jetzt reicht mir „Dominik-kun“.
Wegen der Stimmen auf dem „Flur“ steckt SongMin den verschlafenen Kopf zur Tür raus und redet ein paar Sätze mit SangSu, und das mit einer „Ich bin gerade erst wach geworden“ Stimme, die so niedlich und süß ist, dass ich auf der Stelle Karies kriegen könnte. Danach verschwindet sie wieder hinter der Wohnungstür. Bevor SangSu geht, biete ich ihm an, am Abend doch mit SongMin und Jû bei mir vorbeizukommen, um vielleicht einen Schluck zu trinken und ein bisschen zu „plaudern“, wie man so schön sagt. Er will warten, bis SongMin endgültig ansprechbar ist und Jû überhaupt wach wird (der lernt immer bis drei oder vier Uhr morgens) und verspricht, die beiden zu fragen.
Drei Stunden später treffe ich ihn in der Bibliothek wieder und SangSu teilt mir mit, dass Misi für diesen Abend bereits eine Party geplant habe. Ich habe auch nichts dagegen, da hinzugehen. Bis 1700 schreibe ich drei Berichte und treffe danach Melanie, weil wir zum Ito Yôkadô fahren wollen. Dort befindet sich der Busbahnhof und wir bringen in Erfahrung, wie viel der Trip nach Tokyo mit dem Nachtbus kosten würde. 19.000 Yen wären für Hin- und Rückfahrt zu zahlen, also etwas über 140 E. Das ist nicht wenig, vor allem gerade jetzt, wo ich noch kaum Geld angespart habe. Mein Plan war, bis zum Sommer etwas Geld zurückzulegen, um dann nach Tokyo zu fahren, um auch kommerziell etwas davon zu haben. Meine Geldreserven belaufen sich auf gerade 30.000 Yen, vielleicht ein bisschen mehr, aber 35.000 sind eine großzügige Schätzung. Melanies Planung läuft ja darauf hinaus, über Weihnachten nach Tokyo zu fahren, um mit Ronald und Ricci zusammen Weihnachten verbringen zu können. Natürlich gehen unsere Meinungen da weit auseinander. Für mich ist Weihnachten kein besonderer Tag, also hätte ich nichts dagegen, die kommenden Semesterferien im Frühjahr abzuwarten, um zu fahren. Ich will meine Freunde in Tokyo ebenfalls sehen, aber ich brauche nicht Weihnachten als Anlass. Zwei Monate später ist doch auch in Ordnung, Hauptsache, ich sehe die zwei überhaupt – oder nicht? Auf jeden Fall hätte ich dann auch die notwendigen Reserven, um in Tokyo auch ein paar sehenswerte Dinge besuchen zu können, anstatt mich auf ein Minimum beschränken zu müssen. Natürlich sieht Melanie das völlig anders. Weihnachten sei nun einmal Weihnachten, das sei etwas ganz besonderes und man solle diese Tage mit besonderen Menschen verbringen. Ein Besuch im Februar zum Beispiel sei nicht das Gleiche. Aha, wie soll ich das verstehen? Sind die Freunde weniger besondere Menschen, weil zufällig gerade nicht Weihnachten ist? Ich würde mich immer freuen – aber ich muss doch auch der (finanziellen) Realität Tribut zollen. Wenn ich jetzt nach Tokyo fahre, bin ich nachher pleite, und ich muss vielleicht noch einmal hinfahren, um die Besichtigungen zu machen, die mir so vorschweben. Also doppelte Ausgaben. Das schmeckt mir nicht. Vor allem eingedenk der Tatsache, dass ich möglichst viel Geld auch zurück nach Deutschland nehmen muss, weil ich sonst kein Geld mehr haben werde, um überhaupt meinen Semesterbeitrag zahlen zu können (der zufällig ebenso hoch ist, wie der Preis einer Fahrt nach Tokyo).
Ich könnte – oder muss – meine Internetverkäufe verstärken, damit Geld in die Kasse kommt, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass diese jetzt geplante Reise nach Tokyo die einzige, und mangels Geld eine relativ magere bleiben wird.
Ein Argument muss ich allerdings anerkennen: Ronalds Stipendium läuft am Ende des Wintersemesters aus, und es ist wahrscheinlich, dass er danach sofort zurück nach Deutschland fliegt. Also gäbe es keinen Zeitraum außer um Weihnachten, ihn noch einmal zu sehen, bevor ich wieder bis Oktober 2004 warten müsste… also sei es.
Man lebt nur einmal und wenn mir morgen ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, habe ich von keinem gesparten Geld der Welt mehr etwas. Also folge ich einer feudalen „Tradition“ und mache mich bei einem „Edo sanpô“ („Gang nach Edo“ = Tokyo) arm. Schließlich bin ich der Schwarze Samurai.
Nach der Preisinformation gehen wir ins Ito Yôkadô, weil Melanie weitere Bilder von uns machen möchte – „Purikura“, die man noch selbst an einem an der Kabine integrierten Computer bearbeiten kann, um lustige Fotos daraus zu machen. Wahrscheinlich habe ich darüber bereits geschrieben, also gehe ich nicht weiter auf dieses behämmerte Thema ein – Purikura sind für Kinder! Und von dieser Meinung werde ich in absehbarer Zeit nicht abweichen. Unter Teenagern erfreut sich dieses „Spiel“ jedenfalls der größten Beliebtheit, wie mir scheint.
Der Automat, den Melanie verwenden möchte, ist gerade besetzt, also setze ich mich in die CD Abteilung ab, um auch mal nach den CDs zu forschen, nach denen man mich bereits gefragt hat. Aber ich muss das anders anpacken. Ich finde auf eigene Faust nicht sonderlich viel, und ich will den Angestellten nicht nach allem auf einmal fragen… auch – oder vor allem? – um meinetwillen. Am besten schreibe ich einzelne Zettel mit den Interpreten und besorge mir etwas Vokabular, dass in einer CD Abteilung von Nutzen sein könnte. Am besten fange ich mal mit „bestellen“ an.
Ich finde auch Material, das mich selbst interessieren würde. Eine CD von Ogata Megumi… „Stop and Go“. Habe ich noch nie von gehört. So wie die CDs hier verpackt sind, muss ich annehmen, dass Deutschland den Japanern eine Serviceleistung voraus hat – offenbar kann man eine beliebige CD nicht einfach so anhören. Aber vielleicht hätte ich fragen sollen, anstatt es nur zu vermuten. Ich merke mir die CD einmal. Ah, Hayashibara Megumi findet sich auch, aber nur Singles, mit Ausnahme von „Fuwari“. Was soll ich mit Singles? Ich mache mir eine Notiz für „Fuwari“. Oha, da ist der „ANIMETAL MARATHON“… Nummer Fünf??? Dann habe ich ja einiges verpasst. Aber den nehme ich sofort mit, koste es, was es wolle. Und wenn ich schon dabei bin, nehme ich mir auch eine CD mit dem gaaanz alten „Cutey Honey“ Soundtrack mit. Dem kann ich jetzt nicht widerstehen. Oh, da steht der komplette „Sakura Taisen“ Soundtrack… teuer… aber vorgemerkt.
Dann ist der Automat endlich frei. Melanie darf die Bilder alleine bearbeiten. Mir fehlt das Verständnis dafür, was daran so toll sein soll. Mir fehlt das Interesse, also spiele ich eine Runde „Point Blank“, bzw. es ist wohl eines der Spiele aus der Reihe, und es heißt „Gun Barl“. Barl? Barrel? Japlish? Egal, die Pistole erweist sich als schlecht eingestellt und außerdem ist das Kabel zum Automaten nicht für jemanden gemacht, der größer als 170 cm ist.
Daneben steht ein Automat für ein weiteres Spiel. Und das ist seltsam. Man muss extra Spielmünzen dafür aus einem Automaten ziehen. 100 Yen geben 10 solcher Spielmünzen, „special coins“ (SC) genannt. Der Automat besteht aus einem Glaskasten und sieht ein wenig wie ein Aquarium aus. In dem Kasten bewegt sich ein Schieber vor und zurück, der bis zu einem gewissen Punkt die eingeworfenen Spielmünzen auf den Rand einer Ablage zuschiebt. Man lässt die SC über eine Schiene in den Automaten hineinrollen, und zwar hinter die bereits liegenden Münzen. Die neu eingerollte Münze kommt zum liegen und der Schieber drückt sie gegen die anderen Münzen, die ihrerseits nach vorne geschoben werden und die vordersten Münzen über den Rand hinausschieben. Sinn ist es nun, mehr Münzen aus dem Automaten herauszuholen, als man hineinwirft – wer hätte das gedacht? Machbar ist das eigentlich nur mit dem richtigen Timing. Wann man überhaupt zu spielen beginnt, heißt das. Die Münzen fallen nämlich nicht nur in den Ausgabeschacht, sondern auch in einen Jackpot. Befindet sich darin eine gewisse Menge an Münzen, wird ein sauberer Stapel mit dreißig Münzen auf die Ablage vor dem Schieber geschoben, oder aber ein wilder Haufen von vielleicht 50 Münzen auf die Ablage ausgeschüttet. Man sollte also nur dann spielen, wenn dieser Stapel, bzw. der Haufen, sich bereits sehr nahe am Rand der Ablage befindet. Das war bei mir der Fall – sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, es zu versuchen. Nach dem Einsatz von fünf Münzen habe ich etwa 40 zusätzlich gewonnen, ich habe also 45 in der Hand. Ginge es hier um 10-Yen-Münzen, wäre die Sache in Ordnung und ich nach Hause gegangen, aber es sind ja Spielmünzen. Was soll ich mit dem Müll? Man kann diese Münzen nur in den Kinder-Pachinko-Automaten werfen, die ganzen anderen Spiele funktionieren alle nur mit 100-Yen-Münzen. Also bleibe ich noch eine Zeitlang und verspiele meine ganzen Münzen. Melanie findet es interessant, nachdem sie mit den Bildern fertig ist, und steuert noch einmal zehn Münzen bei, aber dabei kommt nichts Sinnvolles heraus, weil sich keine Münzenansammlung an einem kritischen Punkt befindet.
Anschließend gehen wir ins Daiei und kaufen Getränke und etwas zu Knabbern für unser Erscheinen bei Misi. Wir haben aber auch Hunger und gehen deshalb vorher noch ins Sukiya und essen eine Schüssel Gyûdon. Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Schüssel mit Reis, der unter dünnen Fleischstreifen versteckt ist. Ich war mit Yui einmal hier, als ich meinen Futon gekauft habe.
Dort ruft mich SangSu an. Es ist 19:40, und, ja, eigentlich hätte ich mich schon vor zehn Minuten mit ihm treffen sollen, um zu Misi zu gehen. Ja, aber ich wolle erst was essen. Er könne also losfahren oder gehen. Vielleicht besser „gehen“, denn während des Nachmittags hat es zu schneien begonnen und es hat sich eine mehrere Zentimeter dicke Schneedecke gebildet. Fahrradfahren wird zu gefährlich, aber wir können unsere Fahrräder auch nicht beim Sukiya stehen lassen. Also fahren wir betont langsam und vorsichtig zu Misis Haus.
Wir treffen um 20:15 dort ein. Anwesend sind dort dann Alex (Rumänien), Mélanie (Frankreich), Ramona, Luba, Arpi (Slowakei), Paola (Chile), Irena (Slowenien), SangSu (Korea), Glenn (Philippinen), Misi (Ungarn), Melanie und ich. SangSu hat was zu trinken aus Korea mitgebracht, und auf der Flasche steht „Jinro“ und „25 %“ drauf. Es riecht nach dem Zeug, was man im Krankenhaus zum Desinfizieren verwendet, und der Geschmack überzeugt mich auch nicht davon, dass SangSu sich nicht im hiesigen Krankenhaus bedient hat. Er sagt, man trinke das am besten mit Orangensaft. Leider haben wir aber keinen. Und Jinro schmeckt pur absolut langweilig. Und davon, dass Alkohol drin ist, merke ich auch nichts, obwohl ich kein regelmäßiger Trinker bin. Alex schlägt das Produkt aus Korea – mit einem selbst gebrannten Pflaumenschnaps aus Rumänien, den er in seinem Handgepäck ins Land geschmuggelt hat. Die Hälfte vom Inhalt sei Alkohol, sagt er. Ah ja, dann lass mal probieren, schließlich ist alles besser als Jinro. Das rumänische Produkt ist glasklar und schmeckt in der Tat nach Pflaume. Man spürt, dass Alkohol darin ist, es ist ein sanftes Brennen, dass den Hals hinunter in den Magen gleitet, wo sich anschließend eine wohlige Wärme ausbreitet. Sehr angenehm zu trinken, wirklich. Dabei mag ich eigentlich gar keinen Schnaps… aber ich vertilge zwischen 50 und 100 ml davon. Zumindest behaupte ich, dass es angenehm zu trinken sei. Die Mehrzahl der übrigen Leute sagt, dass es ein scharfes Zeug sei, was Alex da produziert habe. Leider habe ich vergessen, wie das Getränk heißt… ich hätte es aufschreiben sollen, als ich den Namen noch im Ohr hatte.
Nebenbei erfahre ich, dass wir einen VIP unter uns haben. Ich hatte mir irgendeinen Scherz erlaubt, worauf Misi mich angrinst und sagt: „Sei vorsichtig, wie Du mit dem redest – der fummelt an Gehirnen rum!“
Arpi, „Mr. Minority“, ist ein Ungar mit einem slowakischen Pass, und eine Berühmtheit, die uns mit ihrer Anwesenheit ehrt. Natürlich ist er nur in Fachkreisen berühmt. Der Mann ist tatsächlich promovierter Mediziner – einer der führenden Gehirnchirurgen unserer Zeit, um genau zu sein. Er führt uns auch vor, wie gut seine Hände zittern können – wenn er sich Mühe dabei gibt. Er ist ebenfalls zur Fortbildung hier.
SangSu trinkt währenddessen, als gäbe es kein Morgen. Das heißt, er ist es, der den Großteil des Jinro und etwa die Hälfte des Pflaumenschnapses in sich hineinschüttet. Für einen schmal gebauten Koreaner reicht das aus. Er wird sehr lustig, nimmt Irena und Glen bei den Händen und beginnt ein wenig zu singen und zu schunkeln. Um etwa 22:45 muss er wohl auf die Toilette, aber er biegt falsch ab und landet an der Haustür. Misi will nicht, dass er an die Haustuer pinkelt, schon gar nicht an die Innenseite, also folgt er ihm sicherheitshalber. Knapp zehn Minuten später sind die beiden zurück. SangSu hat sich, aus welchem Grund auch immer, auf sein Fahrrad gesetzt und ist einige Meter weit gefahren, bevor er das Gleichgewicht verlor und auf den kalten Boden fiel. Er hat Abschürfungen am rechten Ellenbogen und sein linkes Hosenbein ist völlig durchnässt. Aber er spürt absolut nichts davon und trinkt in einem Zug den Rest von dem rumänischen Schnaps aus.
Um 23:35 (ich habe auf die Uhr gesehen) ist dann Schluss. Er will nach Hause. Es ist auch nichts mehr zu trinken da, also ziehen wir ihm seine Jacke an, packen ihn an den Armen und stützen ihn auf dem Weg nach Hause. Es ist also wirklich sein Vorteil, dass er mit uns im gleichen Haus wohnt. Die Fahrräder lassen wir bei Misi stehen, es hätte keinen Zweck, sie mitzunehmen. Erstens liegt Schnee und zweitens bringen wir einen sehr betrunkenen und nicht gehfähigen Koreaner ins Bett. Drei Fahrräder kann man nicht gleichzeitig befördern. Wir kommen morgen wieder und holen sie ab.
Im Endeffekt tragen wir ihn mehr, als wir ihn nur stützen. Außerdem labert er die ganze Zeit vor sich hin. Auf Japanisch. Ich hätte jetzt erwartet, dass er im Rauschzustand zu Koreanisch zurückkehren würde, aber er redet Japanisch. Wenn auch nur eine Handvoll Vokabeln. „Demo… daijôbu!“ („Aber… mir geht’s gut!“) wird uns wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Und er habe ein schönes Gesicht, behauptet er von sich, „Watashi wa… kirei kao!“ Dann stellt er fest, dass auch wir schöne Gesichter haben und fünf Minuten darauf ist die ganze Welt bevölkert von Menschen mit schönen Gesichtern. Eine Dame, die ihren Hund spazieren führt, weicht uns vorsichtig aus. Ich kann sie auch ein wenig verstehen. Ich entschuldige mich im Vorbeigehen schnell für die Unhöflichkeit. Ja, SangSu, das Leben ist toll. Vor allem wenn man von dem Leiden der Welt befreit ist. Betrunken sein = Nirvana? Ach nein, das Trinken berauschender Getränke ist im Buddhismus ja untersagt. An der letzten Ampel nimmt er sich das Recht, Melanie auf die Wange zu küssen. Ich nehme mir das Recht, ihm einen moderaten Schlag mit der Handfläche an den Hinterkopf zu verpassen. Er wird sich eh nicht mehr daran erinnern.
Wir kommen schließlich zuhause an und eigentlich sind wir auch ganz froh, dass sein Apartment im Erdgeschoss liegt. Mit der untrüglichen Intuition eines Betrunkenen spürt er, dass er daheim ist. Direkt vor seiner Haustür, als Melanie gerade aufsperrt, schläft er ein. Er hat seinen Schlüssel in die Jackentasche gesteckt, und wir dachten einen Moment lang, er habe ihn verloren. Aber jetzt ist er weg vom Fenster. Ich überlege, ihn einfach über die Schulter zu werfen, um ihn in seine Wohnung zu befördern, da er ja nicht viel wiegt. Nicht viel mehr als einen Zentner, würde ich schätzen. Aber wenn ich ihn auf meine Schulter lege, könnte er eventuell seinen Mageninhalt auf meinem Rücken verlieren, und das möchte ich vermeiden. Also nehme ich ihn am Gürtel und schleife ihn in seine Küche, wahrend Melanie das Bett vorbereitet. Sie lässt es sich auch nicht nehmen, peinliche Bilder von ihm zu machen, wie er da praktisch bewusstlos (aber bekleidet) am Boden liegt. Und seine Wohnung muss sie auch festhalten. Eine Junggesellenbude – um es höflich auszudrücken. Hausputz dringend erforderlich. Melanie nimmt daraufhin seine Beine und ich seine Arme, und wir hieven ihn in sein Bett. Wir ziehen ihn aus, soweit notwendig, weil er nasse Füße hat und auch nicht in einer nassen Hose schlafen sollte, und decken ihn zu. Die Zimmertür lassen wir einen Spalt offen und das Licht in der Küche an, damit er problemlos den Weg zur Toilette findet, sollte es im Laufe der Nacht notwendig werden. Hoffentlich kotzt er nicht in sein Bett…
Nachdem wir dann gegangen sind, wartet 20 Meter weiter bereits die nächste Zufallsbegegnung. Jû und SongMin stehen auf dem Gang rum, dick in Jacken eingepackt. Wir klären sie schnell darüber auf, was vorgefallen ist und bitten sie, am folgenden Morgen nach ihm da unten zu sehen. Seine Wohnungstür sei offen, der Schlüssel liege auf der Ablage neben seinem Bett. Ja das sei in Ordnung, und sie bedanken sich, dass wir ihren Landsmann nach Hause gebracht haben. Und sie vergessen auch nicht, sich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Schon in Ordnung. Aber warum die nächtlich Versammlung in dicken Winterjacken? Sie seien von dem plötzlichen Kälteeinbruch überrascht worden und hätten noch kein Öl gekauft. SongMin habe zwar einen elektrisch heizbaren Futon, aber dennoch sei es unerträglich kalt. Man kann m.E. darüber streiten, was „unerträglich“ denn nun sei, aber ich biete den beiden an, von meinem Öl etwas zu nehmen, damit sie übers Wochenende heizen könnten. Nein, das sei schon in Ordnung. Aha, und am Montag ist Feiertag, so weit ich weiß. Es würde ein kaltes und ungemütliches Wochenende werden. Er wolle es bei der Tankstelle versuchen. Nein, muss ich einwenden, die verkaufen kein Kerosin, sondern nur Diesel, und auf den Öfen sei groß aufgedruckt, dass man eben keinen Dieseltreibstoff verwenden dürfe. Die Diskussion wogt hin und her, bis ich schließlich nicht mehr diskutieren will. Ich mache eine fordernde Geste mit der Hand und sage ihm „Tanku wo dashite!“ („Los, schieb den Tank rüber!“). „Ee, kowai!“, sagt Jû und lacht, aber dann holen die zwei endlich ihre Kerosintanks aus den Öfen. Ich gebe jedem von ihnen etwa zwei bis drei Liter Öl, das reicht für knapp eine Woche. Was ich denn nun dafür haben wolle? Nichts eigentlich – aber das ist keine akzeptierte Antwort. Also gut, sagen wir 200 Yen. Dabei dachte ich an 100 Yen pro Nase, aber jeder kommt mit zwei 100er Münzen zu mir. Auch egal jetzt. Ich bin müde und will in mein Bett und nicht um 200 Yen diskutieren. Obwohl ich mir ein bisschen schlecht dabei vorkomme, weil man für 400 Yen etwa 10 Liter Öl bekommt.
Also haben wir heute gleich alle Koreaner in unserem Haus auf einmal „gerettet“. Ich setze mich an den Schreibtisch und halte meine Eindrücke vom heutigen Tag fest, bevor ich die Hälfte wieder vergesse. Das ist jetzt wichtiger, als mein Bedürfnis nach Schlaf. Morgen ist sowieso ein freier Tag. Um 01:50 bin ich fertig damit – und ich freue mich darauf, diesen Newsletter zu schreiben. Es ist spät. Morgen kann (und sollte) ich wohl ausschlafen. Oh ja, der Montag ist ja ebenfalls frei… dann kann ich ja wirklich beruhigt unter meine Decke kriechen.
Osaka scheint – vertreten durch die Osaka Gakuin – eine gute Alternative zu Hirosaki zu sein. Osaka bietet nämlich „Homestay“, i.e. Wohnen in der Gastfamilie.
Ebenfalls eine Misskonzeption meinerseits. „-kun“ wird in der Hierarchie von oben nach unten verwendet, nicht unter Gleichgestellten; und wenn doch, dann nur in der Dritten Person.
Die Realität zeigte mir jedoch einen gangbaren Mittelweg und alles kam besser, als befürchtet…
„Schwarz“ ist ja nun mein Familienname. „Dominik“ wiederum ist Latein und bedeutet „der seinem Herrn dient“; „dienen“ auf Japanisch ist „haberu“ und es schreibt sich mit dem Schriftzeichen „Samurai“.
„PuriKura“ ist die japanisierte Abkürzung für „Print Club“.