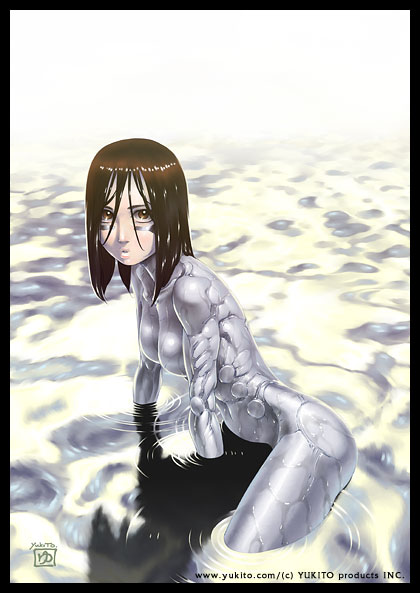Ein sonniger Morgen, laut Wetterbericht sieben Grad Celsius. Zum Frühstück vertilgen wir den Reis, den Melanie gestern leider umsonst gekocht hat (sie hat die Einladung zum Essen bei den Nachbarn zwanzig Minuten zu spät erhalten). Um den Reis warm essen zu können, brate ich ihn an, mit etwas Öl, und das Ergebnis ist, dass mir den ganzen Tag über mehr oder weniger schlecht ist. Das Essen liegt mir wie ein Stein im Magen, und um 1700 habe ich immer noch keinen Hunger. Dabei habe ich doch noch eine Menge Sushi im Kühlschrank…
Aber alles der Reihe nach. Die Tatsache, dass wir am Morgen unsere Zwischenklausur des A2-Kurses zurückbekommen, trägt wohl auch nicht unwesentlich zu meinem Befinden während des restlichen Tages bei. 47 % sind keine Heldentat. Ich würde das „klar durchgefallen“ nennen. Urrghs… warum dieses Ergebnis? So schlecht war ich ja noch nie, so weit es Japanisch betrifft. Es ist natürlich nicht ganz einfach, als Betroffener objektiv darzustellen, wo genau der Wurm drin war, also stelle ich Melanies Interpretation an den Anfang: „Mangel an Vorbereitung!“
Ich will den Vorwurf nicht als völlig unbegründet von der Hand weisen. Ich hätte wohl wirklich mehr dafür tun können – aber wegen des Schwierigkeitsgrades sah ich mich zu besonderen Anstrengungen nicht veranlasst. Das, was hier behandelt wurde, habe ich alles schon einmal gemacht und (damals) mit einem guten Ergebnis hinter mich gebracht, also ist es nicht so, dass ich die Materie überhaupt nicht beherrschen würde. Ich sehe mein Problem darin, wie die Aufgaben gestaltet sind. In Trier bestehen Klausuren aus einer Übersetzungsübung, die den Prüfling dazu veranlasst, die gelernte Grammatik anzuwenden. In Hirosaki bestehen die Aufgaben aus Lückentexten, über denen viel sagend geschrieben steht: „Setzen Sie die richtige Form ein!“
Wenn ich diese Aufgabe nun im Buch sehe, dann ist mir ja wegen des aufgeschlagenen Kapitels voll und ganz klar, auf welche Satzstrukturen die Angelegenheit hinausläuft. Hier ist das nicht der Fall. Ich muss den japanischen Text lesen, trotz der Lücken verstehen, um was es geht, und daraus schließen, was ich in die Lücken schreiben muss – und das alles ohne Wörterbuch (das in Trier bei Übersetzungen aus dem Japanischen ins Deutsche erlaubt ist). Die Mehrheit der Fehler ist wohl dadurch entstanden, dass ich Übersetzungsschwierigkeiten bei den Kanji hatte (= mangelnde Vorbereitung meinerseits) und den Kontext nicht richtig auf den Lehrplan habe umdeuten können (= konzeptionelle Mängel des Lehrmaterials). Die Kanji, die wir für die drei Tests jede Woche lernen müssen, stehen nämlich in keinem direkten Zusammenhang zu den zu behandelnden Lektionen – das ist ein ganz anderes Buch. Die Aufgaben der Klausur stammten jedoch alle aus dem Lehrbuch – was für mich bedeutet, dass ich nicht nur die grammatikalischen Formen können muss (mit dem, was ich an Strukturen vorbereitet hatte, wäre ich bequem auf 80 % gekommen), sondern ich muss auch die Aufgabenstellungen im Buch mehr oder weniger auswendig können, damit ich bei Verständnisschwierigkeiten dennoch weiß, welcher Grammatikteil da gerade abgefragt wird.
Das alles trägt weder zu meiner körperlichen und geistigen Gesundheit noch zu meiner Laune bei. Die Übersetzungsaufgaben von Katsuki-sensei schmecken mir viel besser – schließlich wird man bei der Konversation in der Mensa nicht plötzlich mit Lückentexten konfrontiert… Dass die Klausurtexte Kommunikationsbeispiele waren, macht die Sache nicht besser. Andererseits sitzen in Form der ca. 15 Teilnehmer mindestens fünf Nationen im Raum (Deutschland, Frankreich, Thailand, China und Peru), was eine Übersetzungsübung ziemlich kompliziert für die Lehrerin machen würde. Also muss ich Lernaufwand in die Lehrbuchtexte investieren – was früher völlig überflüssig war. Man könnte aber ruhig ein Kanjilexikon zulassen, um so Vokabelfragen klären zu können und eine vollständige Konzentration auf die Grammatik zu ermöglichen, um die ja eigentlich geht.
Vesterhoven bespricht heute Mishima Yukio und gibt uns „Yûkoku“ („Patriotismus“) zum Lesen mit. Ich bin gespannt. Die „Geständnisse einer Maske“ haben mir sehr gut gefallen, und „Yûkoku“ ist das wahrscheinlich bekannteste Werk Mishimas – nicht zuletzt wegen der Darstellung eines rituellen Selbstmordes… aber das ist bislang alles, was ich darüber weiß, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ich bin gespannt…
… und die Kinnlade fiel mir auf den Schreibtisch. Und ich kann nicht sagen, dass dieser metaphorische Vorgang positive Ursachen hätte. Ich habe nicht gedacht, dass Mishima solch einen Mist schreiben kann. Seine Fans mögen mir das bitte verzeihen, aber ich finde „Yûkoku“ in keiner Weise berauschend. Das einzige, was dieser Text wirklich gut vermittelt, ist der Schmerz eines Mannes, der sich mit einem Katana den Bauch aufschlitzt – und zwar ohne jemanden, der ihm den Kopf abschlägt, wenn es zu viel wird. Ansonsten ist der Text eine Mischung aus chauvinistischen Phrasen, Körperkult und Sex. Nennen wir die Dinge doch beim Namen. Die Handlung findet statt vor dem Hintergrund der Geschehnisse ab dem 26. Februar 1936. In Tokyo rebellierten rund 1400 Soldaten der kaiserlichen Armee (geführt von idealistischen Offizieren der unteren und mittleren Dienstgrade) gegen die Regierung. Ihre Motivation war die Absetzung der Herrschaft von „Parteien, korrupten alten Männern und Bürokraten“, um den Tenno persönlich die direkte Herrschaft zu ermöglichen. Sie hofften, auf diese Art und Weise u.a. die ärmlichen Verhältnisse der Landbevölkerung mildern zu können (die dazu führten, dass eine Menge Töchter in die Prostitution verkauft wurden) – und nicht wenige Offiziere kamen vom Land zur Armee, weil sie dort eine gesicherte Existenz sahen. Der Shôwa Tenno (Hirohito) ordnete am 29.02. jedoch an, die Rebellion niederzuschlagen, worauf die meisten Aufständischen freiwillig die Waffen niederlegten.
Leutnant Takeyama ist die männliche Hauptperson der Kurzgeschichte. Er steht nicht auf der Seite der Aufständischen, aber er weiß, dass man ihm befehlen wird, gegen die Meuterer vorzugehen, unter denen sich seine besten Freunde befinden. Der Leutnant ist verheiratet, und die Darstellung dieser Ehe ist von einem derart archaischen Ideal geprägt, dass einem davon schlecht werden könnte. Seine Frau ist seine absolute Untergebene. Er macht ihr klar, dass es zum Leben eines Offiziers der kaiserlichen Armee gehört, jederzeit sein Leben für Kaiser und Vaterland zu geben und sie macht deutlich, dass sie ihm freiwillig in den Tod folgen werde, sollte dieser Fall eintreten. Es folgen Darstellungen, wie leidenschaftlich (und ausdauernd) das Sexualleben der beiden verläuft (vor allem, wenn er von Übungen wieder zurückkommt), was für einen göttlichen Körperbau die beiden haben (jeweils das extreme Idealbild eines männlichen und eines weiblichen Körpers, man denke dabei an die Vorstellungen der Nazis) und wie hingebungsvoll der Leutnant seinem Kaiser dient. Und als dann klar wird, dass er am folgenden Tag auf seine Freunde und Landsleute würde schießen müssen, nimmt er sein Schwert und verteilt eindrucksvoll seine Darmwindungen auf dem Tatamiboden im gemeinsamen Schlafzimmer (es ist nicht schwer zu raten, was die zwei vorher einige Stunden lang gemacht haben), gefolgt von seiner Frau, die sich mit einem großen Messer den Hals aufschlitzt.
Das möchte ich nicht noch einmal lesen, wenn es sich vermeiden lässt. Aber die Darstellungen der Schmerzen sind so richtig „echt Mishima“. Sehr lebhaft geschildert und gut durchdacht. Immerhin.
Um 1200 gedachte ich eigentlich Yui in der Halle zu treffen, aber sie ist nicht da. Sie ruft auch nicht an. Daraus muss ich eigentlich schlussfolgern, dass unsere Treffen nicht als so regelmäßig ausgemacht worden sind, wie ich mir das gedacht habe. Ein bisschen Kontinuität würde ich doch begrüßen. Ach, was soll’s, ich hab auch schon solche Fehler gemacht. Dafür treffe ich Mei und BiRei, die hier ihr Mittagessen verzehren wollen. Dann unterhalte ich mich eben mit denen ein bisschen, so lange sie essen.
Um 1420 sehe ich Mei dann wieder zum Englischlernen. Derzeit ein überraschend konstanter Faktor in meiner wöchentlichen Freizeitplanung. Mei hat ihr Textbuch vergessen, also nehmen wir das Grammatikbuch als Grundlage. Verbformen. Das ermüdet die junge Dame wesentlich schneller als einfache Kommunikation. Aber die Zeit vergeht dennoch recht schnell und sie hat um 1600 eine Verabredung mit ihrem Tutor. Dann komme ich vielleicht ja doch noch bis 1900 nach Hause, und kann vorher noch Post schreiben.
Aber so weit sollte es nicht kommen. Weit gefehlt! Ich schreibe also den bisherigen Tag in mein Tagebuch und um 1615 kommt BiRei mit XiangHua in die Halle – auf der Suche nach Mei. Sie sei bei einem Treffen mit ihrem Tutor, sage ich, worauf die beiden beschließen, mit mir vorlieb zu nehmen. Wir sitzen also da und unterhalten uns. Währenddessen schreibt BiRei Vokabeln auf, die ich nicht kenne (oder nicht sofort verstanden habe), drückt mir den Zettel in die Hand, sieht mich streng an und sagt: „Lern das und vergiss es nicht!“ Ah… wie Sie wünschen. War von ihr natürlich nicht so ernst gemeint, wie sie es in Szene gesetzt hat. Im Gegenzug möchte sie, dass ich ihr ebenfalls etwas Englisch beibringe. Aber nicht zusammen mit Mei, da sie Mei nicht stören möchte. Dann könnte sie sie doch zumindest fragen, ob das in Ordnung sei? Nein, sie wolle Mei nicht damit belästigen. Und ich solle Mei gegenüber das Thema auch nicht anschneiden. Ich will das jetzt nicht verstehen müssen. In einem klassischen Fernsehdrama würde dieses Verhalten darauf schließen lassen, dass Mei romantische Gefühle für mich hegt und BiRei das weiß, und deshalb die Zweisamkeit nicht stören möchte. 🙂
Aber gut… hier und da ein wenig englische Konversation, wenn wir uns begegnen. Ich solle dann auch von Fall zu Fall unbekannte Vokabeln aufschreiben und an sie weitergeben. Hm… sie hat nach ihrem Schulabschluss erst angefangen, verstärkt Englisch zu lernen, auf der Schule hat sie in erster Linie Japanisch gelernt (acht Jahre), und nur ein bisschen Englisch nebenher gemacht. Eigentlich sollte ich ihr gleich ein Wörterbuch schenken. Mehr als „Basiskommunikation“ ist bei ihr noch nicht zu machen, was bedeutet, dass ich zuerst Vokabeln und dann Strukturen aufbauen muss… das könnte ja in Arbeit ausarten…
Als wir uns dann wieder verabschieden, ist es 1840. Mit „1900 zuhause“ wird das nichts mehr, und ich habe heute noch nicht einmal einen Computer gesehen. Ich werde meine Post abrufen und beantworten, aber einen Bericht schreibe ich heute nicht mehr. Mehrstündige Konversation auf Japanisch kostet mich noch viel zu viel Konzentration und Energie.
Und als ob der Tag nicht schon Kraft raubend genug gewesen wäre, läuft am Abend auch wieder die „WG Kunterbunt“. Heute ausnahmsweise nicht mit Bildern aus den dreißiger Jahren. Es geht ein wenig weihnachtlich zu, und ich denke noch so bei mir: „Hey, dann könnte die Sendung heute ja mal erträglich sein“, aber dann kommt bereits der Dämpfer: „Ernst, wie wir nun mal sind…“ oh nein, oh nein, was kommt jetzt?
„Ernst, wie wir nun mal sind, berichten wir heute über allein erziehende Mütter und Väter in der Weihnachtszeit.“
Okay, ich gebe zu, das ist besser als „Weihnachten unterm Hakenkreuz“, aber immer noch viel zu deprimierend für eine Kindersendung! Ich sagte ja bereits, dass die Themen, die ja nicht unwichtig sind, inhaltlich eher was für Jugendliche wären – hätte die Sendung nicht allgemein eine so kindgerechte Aufmachung. Warum zeigen die keine Weihnachtsmärkte? Von mir aus auch mit alternativem Holzspielzeug „made in Germany“. Oder verschneite Bäume, spielende Kinder mit Schlitten und dergleichen mehr? Nein, wir zeigen lieber die Kehrseiten der Medaille und lassen die Japaner denken, dass Deutsche sich nur über schwermütige Themen Gedanken machen. In Deutschland ist Weihnachten also nicht das Fest der Freude, sondern das Fest, wo man an weniger gut situierte Menschen denkt und Trübsal bläst. Etwas mehr Ausgewogenheit wäre hier angebracht – und unter „Ausgewogenheit“ verstehe ich etwas anderes als die Laberbacke Sascha mit seinen Fußballbegriffen… wenn Deutsche sich von ihrer Trübsal mal lösen wollen, spielen sie also Fußball oder sehen sich Spiele an. Wie könnte es auch anders sein?
„Prinz Pipo“ gibt am Ende der Sendung jeweils den Satz des Tages vor. Vielleicht habe ich das bereits erwähnt – es handelt sich dabei um den Kernsatz des vorgeführten Puppentheaterstücks, und dieser Satz wird mehrfach erwähnt, damit ihn sich auch jeder merkt. Und der lautet heute:
„Eigentlich dachte ich, dass die Natur auf der Erde intakt ist.“
Muss man Germanist sein, um diesen Satz als „auffällig“ zu betrachten? Ich bin keiner, und ich behaupte dennoch, dass der Satz nicht ganz richtig ist (ich will nicht direkt „falsch“ sagen). Müsste das hier nicht heißen:
„Eigentlich dachte ich, dass die Natur auf der Erde intakt sei.“ ???
Vielleicht gibt es Konnotationsunterschiede, die mir unbekannt sind? Annahmen werden wie indirekte Rede doch im Irrealis ausgedrückt, oder? Für mich ist meine Version jedenfalls richtiger. Übel Freunde, ganz schlecht.
Und dann fängt es an zu schneien.