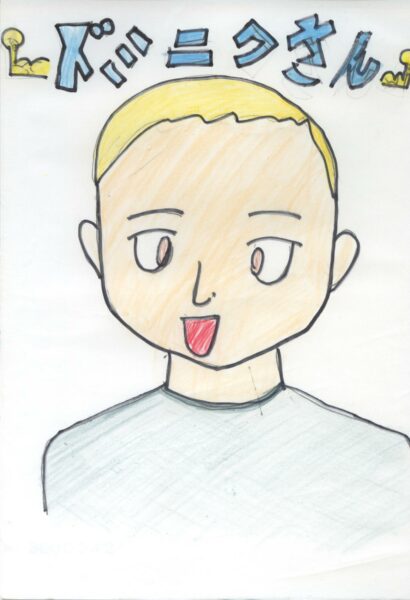…doch ich armer Arbeitsloser wollte nicht mehr joblos sein.
Am 8. März erhielt ich einen Anruf in englischer Sprache, den ich erst gar nicht zuordnen konnte. Nach einigen Sätzen erst wurde klar, dass man mich zu einem Vorstellungsgespräch einlud. Nach Oberammergau. Ob ich in zwei Tagen, am 10. März um 16 Uhr, kommen könne, oder ob mir ein Telefoninterview lieber sei. Ich bat mir zwei Stunden Zeit aus, um zu prüfen, ob mir ein Kommen technisch und finanziell überhaupt möglich war.
Oberammergau? Am Südende Deutschlands also. Und, ach Du lieber Himmel – Passionsfestspiele! Ich erinnerte mich nur dunkel, dort einmal eine Bewerbung hingeschickt zu haben. Laut meiner Unterlagen hatte ich mich Ende Dezember beworben. Nach zwei Monaten Wartezeit hatte ich die Hoffnung aufgegeben. Die Jobbeschreibung war nicht mehr aufzutreiben, und den Trick, wie man Seiten im Internet findet, die es eigentlich nicht mehr gibt, kenne ich nicht mehr. Aber in dem Moment hatte ich eher kurzfristige Sorgen. Natürlich wollte ich meine Motivation unter Beweis stellen und lieber hinfahren, als fast anonym angerufen zu werden. Abgesehen davon bin ich gern mit dem Auto unterwegs. Aber die Frage der Kosten musste geklärt werden.
Anruf beim Arbeitsamt, bei meinem Vermittler, etwa um halb drei. Da ging keiner ans Telefon. Also bemühte ich mein soziales Offlinenetzwerk, mein Dank an Alex, und erhielt die Versicherung, dass mich bald jemand anrufen werde, der mir weiterhelfen könne. In der Zwischenzeit organisierte ich mehrere Reiseetappen: Mein Vater musste mir sein Auto leihen, damit ich nicht vom fahruntauglichen Großvater in Saarbrücken abgeholt werden musste. Der Großvater musste mir wiederum sein Auto leihen, damit ich nach Oberammergau und wieder zurück kam, was die Kiste meines Vaters nicht gewährleistete. Und weil ich nicht knapp tausend Kilometer inklusive eines nervlich sicherlich nicht anspruchslosen Vorstellungsgesprächs am selben Tag bewältigen wollte, organisierte ich eine Übernachtung bei einem alten Kameraden in Stuttgart, den ich seit etwa elf Jahren nicht gesehen hatte.
Schließlich kam der Anruf vom Arbeitsamt. Mein Vermittler sei im Urlaub und seine Vertretung bereits um 12 gegangen. Eigentlich müsse ich den Antrag vor Reisebeginn stellen und dafür eine schriftliche Einladung des potentiellen Arbeitgebers vorlegen. Nun musste ich aber morgen bereits aufbrechen, weil ich sonst ja nicht am frühen Morgen des 10. März losgekommen wäre, und das ist zu knapp, um noch eine schriftliche Einladung zu erhalten und den Antrag zu stellen. Das sei aber in Ordnung, sagte die Dame am Telefon, sie habe meine mündliche Mitteilung festgehalten und ich könne und müsse die notwendigen Schriftstücke nachreichen, den Antrag werde sie mir umgehend zusenden.
Dann blieb also nur noch, mit dem amerikanischen Anrufer zu klären, wie das mit den Fahrtkosten handhabbar sei, außerdem wollte das Arbeitsamt natürlich wissen, wie denn die Organisation hieß, die cih besuchen würde. Da mir die Daten des Jobs nicht mehr zur Verfügung standen und meine Notizen nur sagten “Computer Assistant, Oberammergau, US Army”, musste ich natürlich noch ein bisschen was in Erfahrung bringen. Schließlich heißt es, dass Arbeitgeber es mögen, wenn man sich über ihren Laden informiert und zumindest oberflächliches Insiderwissen ins Bewerbungsgespräch einstreuen kann.
Nur kam der versprochene Rückruf um 1630 nicht. Ich rief um kurz nach fünf also selber an, aber da hatte der Anrufer scheinbar bereits Feierabend. Das würde die Angelegenheit ein bisschen verkomplizieren, aber es würde sich sicherlich eine Lösung finden.
Am Morgen des 9. März saß ich also ab 0800 neben meinem Handy und wagte kaum, aufs Klo zu gehen. Kurz vor halb Neun war es dann soweit: Der potentielle Arbeitgeber würde die Fahrtkosten wohl nicht übernehmen, aber man würde mir auf jeden Fall die notwendigen Dokumente zur Verfügung stellen, um meinen Rückerstattungsantrag (offiziell: “Antrag auf Gewährung einer Förderung aus dem Vermittlungsbudget gem. § 16 Abs. 1 Sozialgesetzbuch – Zweites Buch – (SGB II) i.V.m. § 45 Sozialgesetzbuch – Drittes Buch – (SGB III)”) zu ermöglichen.
Und bei dem Arbeitgeber handelte es sich um die “NATO School Oberammergau” (NSO). Klingt sehr interessant. War natürlich lustig, als der Anrufer versuchte, mir klarzumachen, dass die Adresse “Am Rainenbichl 54” lautet. Man versuche das mal als Amerikaner, der nur das allernotwendigste Deutsch spricht. Die etwa fünfminütige Unterhaltung wurde also zu einem nicht unwesentlichen Teil in Form von Buchstabierungen gemäß des NATO-Alphabets geführt, um sicherzugehen, dass wir die richtigen Daten übermittelten.
Im Anschluss gab ich die erhaltenen Daten noch telefonisch an das Arbeitsamt weiter und nachdem ich meinen Anzug verpackt hatte, konnte die erste Reiseetappe losgehen.
Bus zum Bahnhof. Verdammt, ich habe meine Kamera vergessen!
Zugfahrt Richtung Völklingen, kostet 13,90 E. Die Zeit konnte ich mir mit dem aktuellen Trierischen Volksfreund vertreiben, den ein Fahrgast an diesem Morgen liegen gelassen hatte. Darin ein Artikel zur Geschichte der Fastenzeit, in dem unter anderem zu lesen war, dass man Maultaschen in Schwaben wohl auch “Herrgottsbescheißerle” nennt, weil man in der Teighülle Fleisch “verstecken” konnte. Vielleicht hätten sie’s besser “Pfarrerbescheißerle” genannt, denn wenn man an Gott glaubt, kann und muss man davon ausgehen, dass der sich in seiner allmächtigen, allwissenden und allsehenden Art wohl kaum von einer Teighülle täuschen lässt.
In VK einen Tee getrunken und in die Klapperkiste des Vaters gesprungen, und nach Gersheim gefahren. Nach dem Mittagessen habe ich einen alten Freund im Ort angerufen und ihn gebeten, mir seine Internetverbindung mitsamt Drucker und Papier zur Verfügung zu stellen. Ich recherchierte dort also die NSO und zog mir alle Texte über Geschichte, Aufgaben, und Unterrichtspläne, dazu noch die Grunddaten der NATO seit ihrer Gründung, insgesamt 25 klein bedruckte A4 Seiten. Das drückte ich mir den Nachmittag über in den Kopf, und am Abend entfernte ich den übermäßigen Haarwuchs auf demselben. Für einen Film am Abend hatte ich gar keine Zeit.
Die Seiten der NSO weisen eine Reihe von Grammatik- und Rechtschreibfehlern auf, zudem existiert dort ein Mischmasch von amerikanischem und britischem Englisch, und zuletzt wird dort mit militärischen Abkürzungen herumgeworfen, dass ein unbedarfter Leser keine Freude dabei haben dürfte. Akronyme wie SHAPE, SACEUR oder JFCOM werden entweder gar nicht oder erst an späterer Stelle erklärt. Auch das Webdesign erschien sogar mir stellenweise amateurhaft, hauptsächlich wegen der Uneinheitlichkeit zwischen den einzelnen Fachbereichen. Das hätte ich mir ein bisschen professioneller vorgestellt.
Als letztes schnitt ich mir noch die Haare auf die üblichen sechs Millimeter runter, Rasieren würde ich mich morgen früh.
Am andern Morgen Aufstehen um 0615. Gemäß dem mir innewohnenden Alarmwecker für Tage mit hoher nervlicher Belastung erwachte ich selbständig um exakt sechs Uhr, und das hatte seinen Grund nur zum Teil in der vermaledeiten Turmuhr am anderen Ende der Wohnung mit ihrem verdammten Glockenschlag.
Nach dem abendlichen Sechsmillimeterschnitt am oberen Ende am Morgen also Entfernung des Haarwuchses unterhalb der Brille. Wie schön, ich hatte auch meinen Rasierer vergessen. Das hieß, ich musste auf die Packung Einmal-Rasierer des Großvaters zurückgreifen. So ein widerliches Kroppzeug kann man sich kaum vorstellen, mein Gesicht sah nachher aus wie ein rohes Schaschlik, nur ohne Spieß drin. Ich entfernte die Blutkrusten durch eine letzte Gesichtswäsche, bevor ich mich aufmachte, und zum Glück war es damit dann gut.
Abfahrt Richtung Südosten um 0720. Das Navigationsgerät zeigt mir eine geschätzte Reisezeit von knapp fünf Stunden, aber bei einer Strecke von über 400 Kilometern ist es nicht auszuschließen, dass es Schwierigkeiten mit Baustellen und was weiß ich noch was geben kann. Ich rechne einfach mal mit sechs Stunden.
Landstraße nach Zweibrücken, Autobahn und Bundesstraße Richtung Landau, durch Hinterweidenthal und das Trifelsland. Schließlich Autobahn nach Karlsruhe, von dort in Richtung Stuttgart. Auf der Strecke holte ich mir mein erstes Premiumfoto wegen überhöhter Geschwindigkeit. LKW mit 120 überholt, währenddessen Begrenzung auf 100. Direkt nach Abschluss des Überholmanövers Begrenzung auf 80. In der Regel gehe ich nicht in die Eisen, sondern nehme einfach den Fuß vom Gas. Leider ging’s da aber leicht bergab – als es in der nächsten Kurve blitzte, standen immer noch etwa 100 km/h auf dem Tacho. Es gibt halt immer ein erstes Mal und bei der nächsten Gelegenheit bemühe ich halt lieber die Bremsklötze.
Die Nachrichten im Radio verkünden mir eine Weile später ein interessantes Urteil eines Kölner Gerichts: Es soll Hartz-IV-Empfängern verboten werden, Glücksspiele zu spielen. Klingt an sich vernünftig, weil man dabei in erster Linie an die dämlichen Automaten in der Kneipe und an verantwortungsloses Pokern in verrauchten Nebenzimmern denkt – aber wie ich später höre, schließt dieser Begriff ganz locker auch Lotto ein. Wie man als Betreiber einer Lottoannahmestelle einen Hartz-IV-Empfänger erkennt, ist mir nicht klar, aber vielleicht wird ja demnächst verlangt, dass man sich einen “Hartz-IV-Stern” an die Jacke näht? Laut dem zitierten Urteil drohen bei Missachtung des Verbots bis zu sechs Monate Gefängnis oder eine Geldstrafe von 250.000 E. Zweihundertfünfzigtausend Euro. Von einem Sozialhilfeempfänger. Es gibt Dinge, die sind so scheiße, dass man drüber lachen muss, um mal den Feldwebel Diete (1998) zu zitieren.
Wie wäre es, wenn diese scheinbar gelangweilten Bürokraten die Leute mit den paar Kröten, die sie nicht zum nackten Überleben brauchen, machen ließen, was ihnen Spaß macht?
Von Stuttgart in Richtung Kempten, um kurz nach Elf machte ich eine kurze Pause. Ist das zu glauben? Der Fruchtsaft, den ich mir für die Fahrt gekauft hatte, steht noch in der heimatlichen Küche! Zum Aus-der-Haut-fahren ist das doch! Dann muss es eben ohne gehen, bis ich in Oberammergau vielleicht was zu trinken kaufen kann.
Im Radio hörte ich, wieder unterwegs und wohl anlässlich der christlichen Fastenzeit, einen Beitrag über Verzicht und Sucht, am Beispiel des Alkoholismus… wenn ich mir vornehme, eine Woche auf Alkohol zu verzichten und schaffe es nicht, dann ist der Fall wohl klar, aber ebenso bedenklich sei es, wenn allein die Überlegung eines solchen Verzichts schon Gegenreaktionen hervorruft (“Ach was, das ist doch nicht nötig…”)
Irgendwo bei Kempten sollte ich dann von der Autobahn abfahren und auf der Landstraße weiter nach Oberammergau reisen. Ja, sollte, hätte, würde. Die Autobahn da unten ist nämlich neuer als die Daten im Navi. Das Navigationsgerät geht nämlich noch davon aus, dass die Autobahn mitten in der Vorgebirgspampa aufhört und in eine untergeordnete Straße überleitet. Ist aber nicht mehr so. An dem Punkt, wo mir die Abfahrt signalisiert wird, befindet sich keine solche, und auch danach kommt keine weitere Abfahrt. Schließlich durchfahre ich einen Tunnel und werde auf der anderen Seite durch ein Schild in Österreich willkommen geheißen, und die Autobahn hat sich in das Gegenstück zur deutschen Bundesstraße verwandelt.
Positiv an dieser Situation war aus ästhetischer Sicht eindeutig das schöne Wetter, das herrschte, denn bei Sonnenschein sehen die Alpen schlicht besser aus, als wenn es bewölkt ist, und aus technischer Sicht, dass das mir vorliegende Navigationsgerät auch Österreich mit einschließt. Ich wurde am so genannten Plansee vorbeigeführt, der zum Großteil geradezu malerisch zugefroren ist, durch ein beschauliches Dorf mit dem Namen “Kretzelmoos”, wo der Sprit auch nicht billiger zu sein scheint, als bei uns, anschließend über einen Pass, wo noch meterhoch der Schnee und stellenweise Eis auf der Straße liegt, bis ich dann auf einer unauffälligen Landstraße einen ebenso unauffälligen Grenzübergang überschritt, und mich auf den letzten 20 Kilometern Oberammergau von Südwesten her näherte, anstatt von Nordwesten.
Um kurz nach 13 Uhr war ich in Oberammergau und stand auf dem Parkplatz der dortigen Kaserne. Die Architektur der drei- bis vierstöckigen Gebäude aus den Dreißigern hat etwas Bedrohliches an sich. Die Anlage war 1934 eröffnet worden und beherbergte ursprünglich die 54. Gebirgsfernmeldekompanie der I. Gebirgsdivision. Die NSO befindet sich in einem weiter abgegrenzten Bereich der Kaserne, deren frei zugänglicher Teil die Verwaltungsschule der Bundeswehr beherbergt.
Ich hatte also noch drei Stunden Zeit. Ich nutzte sie, um meine Notizen zur NSO noch einmal durchzugehen und ging zwischendurch auf eine Toilette der Verwaltungsschule. Ich fragte eine der Angestellten, ob man hier irgendwo was zu trinken kaufen könne. Ja, es gebe eine Kantine… aber halt, die sei heute ausnahmsweise geschlossen, weil wegen des Faschings die Kurse später angefangen hätten und nichts los sei. Einen Supermarkt gebe es in der näheren Umgebung nicht. Diese Information erhielt ich übrigens in einwandfreiem Hochdeutsch, was ich hier in Bayern so nicht erwartet hätte.
Ich ging um 1530 zum Tor, wo ich mich anmelden sollte. Noch bevor ich begriff, dass es sich auch hier um eine private Sicherheitsfirma handelte, sprach ich den Wachmann in englischer Sprache an, sah dann das Abzeichen seiner Firma, und dann hörte ich die Art und Weise, wie er Englisch redet. Wir wechselten also zu Deutsch, und ich würde den Dialekt für zwei Drittel Österreichisch und ein Drittel Bayrisch halten. Eine interessant klingende Mischung, die mir weniger “großkopfert” vorkommt, wie die Münchner Vorlage.
Wie dem auch sei, ich stand nicht auf der Besucherliste. Wie habe ich bei einer militärischen Organisation auch erwarten können, dass solcherlei Dinge glatt laufen? Wer mich denn eingeladen habe, fragte der Wachmann. Auch darauf konnte ich keine Antwort geben, weil ich diese Angabe am Telefon nicht verstanden habe. In der Regel nennt der Gegenüber seinen Namen in der kurzen Phase, die ich brauche, um auf Englisch umzuschalten. Ich machte also auf dem Absatz kehrt, ging zurück an das Auto, kramte mein Telefon hervor, und wählte die Nummer, von der die Anrufe bislang kamen. Mein Kontaktmann versprach, das zu klären. Ich ging also wieder zum Wachmann, der mir einen Besucherausweis für meinen Personalausweis überreichte und mich in ein kleines Nebengebäude 80 m weiter schickte. Dort sollte ich beim Master Sergeant vorsprechen.
In dem grauen Containerbau befinden sich ein großes und eine Handvoll kleinerer Büros, nebst einer Toilette direkt am Eingang. Ein klassisches Geschäftszimmer, eine Soldatin links am Rechner, ein Soldat rechts am Rechner. Ein paar eher unauffällige Details im Raum lassen die Vermutung zu, dass diese Verwaltungsstelle von der US Air Force betrieben wird. Ich müsse wohl noch etwa 20 Minuten warten, sagt der Soldat rechts und weist mir einen Bürostuhl neben der Eingangstür zu.
Wo ich den herkäme, wollte er dann wissen. Ich werde mit “Sir” angesprochen, fühlt sich irgendwie irre an…
Saarland? “Äh…” Kennt er nicht.
Trier? “Äh…” Kennt er auch nicht.
Bitburg? “Ah!” Davon hat er gehört. Ich unterlasse die Frage, ob er es wegen des Biers oder wegen des Luftwaffenstützpunkts in der Gegend kennt.
Ich fragte lieber, ob schwarze Stiefel bei der Armee außer Mode geraten seien. Er gab an, dass er zuletzt 2003 schwarze Stiefel getragen habe, seitdem gebe es eigentlich nur noch die sandbraunen Exemplare aus Wildleder. Das sind ja tolle Aussichten für mich, ein Paar schwarzer Armeestiefel aufzutreiben.
Kurz darauf kam ein amerikanischer Gefreiter herein und sagte, er überbringe eine schriftliche Anfrage (“request”). Die Soldatin links nahm das Blatt entgegen, runzelte die Stirn und fragte ihn:
“Wie schreibt man request?”
“Nun, R-E-Q…” Er zögerte eine Sekunde.
“R-E-Q-U-E-S-T! Da ist ein U drin!”
“Echt? Oh…” Er nahm eines von diesen Korrekturbändern vom Schreibtisch, strich das falsche Wort aus und schrieb es mit einem Kugelschreiber richtig drüber. Ich amüsierte mich prächtig. Elitäre Verhältnisse bei der NSO.
Dann kam der Master Sergeant herein. Ich hätte, der Stimme am Telefon nach zu urteilen, alles mögliche andere erwartet, aber nicht einen Schwarzen Ende 20 von 1,65 m. Immerhin macht er einen geistig wacheren Eindruck als sein dröges GeZi-Personal. Er führte mich in das größere Gebäude nebenan, in das Besprechungszimmer, wo das Bewertungskomittee saß. Mich empfing ein dicker Oberst der Bundeswehr, neben ihm ein Oberstleutnant der gleichen Armee, und eine Dame um die Fünfzig in Zivil. Der Master Sergeant war der einzige Amerikaner im Raum, und der ist noch nicht mal von der Army, an die ich die Bewerbung mal geschickt hatte. Ich war etwas verwirrt. Man wies mir auf Deutsch einen schwankenden Stuhl zu (also einen Bürosessel, dessen Ausrichtung sich dem jeweiligen Körperschwerpunkt angleicht) und führte dann das Gespräch in englischer Sprache weiter. Die beiden Leute von der Bundeswehr haben einen schier grausamen Akzent, ihre Grammatik weist Fehler auf. “Thank you for your informations.” Alles klar? Warum musste ich gerade von solchen Leuten interviewt werden? Nicht, dass die beiden Offiziere unsympathisch wären, aber ihre Art, Englisch zu sprechen, hat auch nicht dazu beigetragen, dass ich in die Situation hineinfand.
Ich glaube nicht, dass das Gespräch günstig für mich gelaufen ist. Ich habe mir eine Menge Zeug zurecht gelegt, aber da ich in mündlichen Prüfungssituationen zur Nervosität neige, habe ich die Hälfte davon vergessen, was zum Beispiel die Heraushebung persönlicher Stärken betrifft. Ich muss davon mal eine schriftliche Liste erstellen, damit ich mich an die auch unter Stress erinnern kann. Ich hätte spontan erwähnen können, dass ich Englisch besser schreibe, als so mancher Muttersprachler hier am Standort.
“Warum bewerben Sie sich für diese Stelle?” fragte der Oberst gleich zu Beginn. Anstatt also die landschaftlichen Vorzüge des Allgäus zu loben, auf Alpenurlaube meiner Kindheit hinzuweisen (womit ja eine persönliche und emotional nachvollziehbare Motivation genannt worden wäre), und letztendlich vom guten Ruf der NSO zu lobhudeln, wo meine Anstellung nur verglichen werden könne mit dem Videospielfreak, der ein Jobangebot von Nintendo erhält, zerschoss ich mein Anliegen sofort mit der ebenso wahren Geschichte, dass ich lediglich wegen der Jobbeschreibung, in der von Berufserfahrung keine Rede war, auf den Gedanken gekommen war, dass ich für die Arbeit geeignet sei und dass ich im Grunde nur versuchen wolle, auf dem Jobmarkt Halt zu bekommen. Die Aussage tat mir im gleichen Moment leid, in dem ich den Satz beendet hatte. Goodbye, Oberammergau.
Von der Frage nach meiner Erfahrung im Bildungsbereich müssen wir gar nicht reden. Bis zu genau dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, es handele sich um einen Verwaltungsjob, für den man eben MS-Office-Kenntnisse braucht. Erst, als die Frage nach meiner Erfahrung im Bildungsbereich kam, ging mir ein Licht auf: Es geht nicht nur um Verwaltung – es geht um die Entwicklung und die Bereitstellung von Lerninhalten für die internationale Gemeinschaft von Offizieren und Unteroffizieren, die hier weitergebildet werden soll. Ich konnte an der Stelle nur darauf verweisen, dass Zweitspracherwerb mit Hilfe von elektronischen Korpora immerhin ein Schwerpunkt meiner Universitätsausbildung war, und dass ich zumindest über theoretisches Wissen über die Anwendung pädagogischer Inhalte am Rechner verfügte. In dem Moment fragte ich mich, warum die mich überhaupt eingeladen hatten, denn schließlich möchte ich mal ausschließen, dass hier Dutzende von Leuten vorsprechen und nicht ein Großteil von denen bereits über das hier geforderte Hintergrundwissen verfügt.
Ich glaube, die einzig gute Antwort, die mir einfiel, gehört zu der Frage, warum ich der Meinung sei, ich sei der beste für diesen Job geeignete Bewerber. In einem Anfall von rhetorischem Geschick (und selbst das ist im Nachhinein fragwürdig) wies ich darauf hin, dass es dumm von mir wäre, genau das zu behaupten, nämlich der beste zu sein, dass ich aber stattdessen mit gutem Gewissen behaupten könne, die mir gestellten Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen.
“Haben Sie noch Fragen?” Mir fällt in der Regel auf die Frage nie was ein, aber in diesem Fall interessierte mich natürlich, ob mir im Falle des Falles jemand helfen könne, eine Wohnung für zwei zu finden, und wie die Mieten seien. Ja, Hilfeleistung bei der Wohnungssuche sei auf jeden Fall drin, und die Warmmieten für 2ZKB lägen so bei 450 E.
Außerdem interessierte mich die Frage, warum man jemanden wie mich, der über keinerlei konkrete Berufserfahrung in dem gewünschten Feld verfügt, denn überhaupt eingeladen habe. Das entscheide die Personalstelle des Hauptquartiers in Stuttgart, erzählte mir der Oberst. Er erhalte nur die Daten der Auserwählten, lade sie ein, stelle ihnen die notwendigen Fragen, und gebe anschließend seine Auswahlempfehlung weiter.
Kurzum, wenn man mich nicht wegen meines sympathischen Auftretens nimmt, ist dieser Zug abgefahren. Ich verabschiedete mich nach etwa 20 Minuten und ging zum Auto zurück. Da war es zwanzig vor Fünf. Ein eher zufälliger Blick auf meine Notizen offenbarte mir aber etwas, an das ich hätte denken sollen: Ich brauche schriftliche Nachweise meiner Einladung und meiner Anwesenheit. Ich wählte erneut die Nummer des Master Sergeants, aber der war in jenem Moment bereits mit dem nächsten Bewerber beschäftigt und ich erwischte nur den geografisch unbegabten GeZi-Soldaten. Ich solle in 30 Minuten noch einmal anrufen, sagt der.
Ich döste also im Auto vor mich hin, bei offenem Fenster. Auf dem Parkplatz, auf den die Sonne herabschien, war es fast frühlingshaft warm. Ein paar Meter links von mir befand sich eine Mauer, hinter der sich die Wohnanlage der NSO verbirgt. Ein paar Kinder spielten direkt hinter der Mauer, am deutlichsten dabei ein Englisch sprechender kanadischer Junge, der im Laufe der halben Stunde dreimal “What the balls!?” ausrief. “What the fuck?” ist für Angehörige von Offizieren wohl zu vulgär, und auch “What the hell?” scheint irgendwie verpönt. Ich hätte daher mit “What the heck?” gerechnet, aber “What the balls?” ist mir völlig neu, und auf Grund der dennoch inneliegenden sexuellen Anspielung sehr amüsant. Dass es sich um einen jungen Kanadier handelte, konnte ich daraus erfahren, dass im Laufe meines Zuhörens weitere Kinder den abgesperrten Bereich betraten, denen er sich dann als Kanadier vorstellte.
Um Viertel nach Fünf rief ich erneut im Geschäftszimmer an, aber der Master Sergeant war immer noch nicht da. Ich schilderte also dem Soldaten am anderen Ende der Leitung die Lage quasi zweimal, bis ich das Gefühl hatte, dass er verstanden hatte, was ich brauche, damit mir die Bürokratie meine Reisekosten ersetzt. “Das ist aber nett!” sagte er dazu. Ich hätte ihm beinahe einen Vortrag über den Unterschied zwischen sozialer Sicherheit einerseits und dem amerikanisch-konservativen Hirngespinst von der “sozialistischen Sicherheit” andererseits gehalten, aber ich hielt mich zurück.
Um zwanzig nach Fünf aß ich mein zweites Brötchen und machte ich mich dann endgültig auf den Weg, und binnen der kommenden 30 Kilometer brauchte ich dringend eine Tankstelle. Ein Supermarkt wär auch nicht schlecht gewesen, denn ich hatte mittlerweile Durst. Ich fuhr in den Ort hinein, um zu sehen, ob ich vielleicht eines der bekannten Markenschilder entdecken konnte. Die Gassen sind eng und verwinkelt, die Verkehrsführung unübersichtlich, weil hier die Häuser scheinbar nach Zufallsprinzip nebeneinander gestellt wurden und Jahrhunderte später hat man einfach an den breitesten Stellen eine Straße durchgeführt. Ich fand eine Apotheke, das Rathaus, das sich von den anderen Häusern nicht so deutlich unterscheidet, einen Laden für Schnitzereien, für sonstige Andenken, zwei kleine Elektroläden, Pensionen und Hotels, aber der einzige Laden, in dem es was zu trinken gibt, ist ein Spirituosengeschäft.
Wie durch ein Wunder fand ich ohne große Probleme wieder aus der dörflichen Innenstadt heraus und fuhr zurück Richtung Kempten, diesmal ohne Ausflug nach Österreich.
Nach Oberammergau durchquerte ich Unterammergau… später tankte ich dann in Saulgrub… die Bayern haben schon lustige Ortsnamen. Wenn hier in Kenn lauter Kenner wohnen, dann muss ich wohl davon ausgehen, dass da unten in Söld ausschließlich Söldner leben.
Ein Kalauer, hahaha!
Im Radio lief ein Informationsprogramm zum Thema Darmkrebs, dessen Auftreten bei Menschen über 50 sprunghaft ansteigt, für den es allerdings mittlerweile gute Früherkennungs- und Heilverfahren gebe. Spätestens ab dem 54. Lebensjahr kann man anscheinend von der Krankenkasse bezahlte Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen.
In Saulgrub hatte ich meine erste feindliche Begegnung mit der E10 Zapfsäule und ging erst mal an die Kasse, um Informationen zu meinem Autotyp zu erhalten. Zu Peugeot stand da geschrieben, dass alle Modelle, die nach 2000 gebaut worden sind, E10 vertragen. Ich glaube mich allerdings zu erinnern, dass das vorliegende Modell bereits Ende der Neunziger gebaut worden ist. Ich hätte in den Papieren nachsehen können, aber ich kam in dem Moment nicht drauf. Abgesehen davon tanke ich grundsätzlich Super Plus, bzw. Treibstoff mit einer Oktanzahl von mehr als 95, weil der Motor besser läuft und das Plus an Reichweite den Preisunterschied ausgleicht. Auch die Angestellte hier sprach ein überraschend sauberes Hochdeutsch. Sind es dann letztendlich doch die Schwaben, bei denen man niemanden findet, der es beherrscht?
Mein erster Versuch, auf die Autobahn zu kommen, scheitert ebenso wie mein vergangener Versuch, sie zu verlassen: Statt einer Auffahrt sehe ich an der im Navigationsgerät vorgesehenen Stelle eine Baustelle von einem halben Hektar. Dann also weiter durch die Landschaft, versorgt mit Informationen zum Thema Darmkrebs. Als der Sender auf der Autobahn Richtung Stuttgart dann zu schwach wurde, fand ich woanders einen Beitrag über eine Buchhändlerin, das heißt die Besitzerin der so genannten “Literaturhandlung”, aus München, eine Frau Dr. Rachel Salamander. Scheinbar eine interessante Persönlichkeit, die mit Literaturgrößen wie Reich-Ranitzky auf Du-und-Du ist, und natürlich konnte der Moderatur sich den Seitenhieb nicht verkneifen, indem er fragte, ob sie denn eine “echte” Doktorin sei. Ja, sie hat summa cum laude in Mediävistik promoviert.
Bei der Einfahrt in Stuttgart dann eine Sendung zum Thema Hartz-IV, die ich leider nicht zu Ende hören konnte. Es ging um einen Geisteswissenschaftler, der unter anderem Philosophie studiert hatte und nach seinem Abschluss ein Jahr arbeitslos gewesen war. In diesem Jahr hat er wohl seine Erfahrungen mit den Arbeitsämtern protokolliert und dann ein Buch darüber herausgegeben, und vieles von dem, was er erzählte, entsprach voll und ganz meinen eigenen Eindrücken: Dass zum Beispiel das Personal der Arbeitsämter mit Universitätsabsolventen völlig überbeansprucht ist und selbst nicht weiß, was man mit denen anfangen kann, und dem entsprechend fielen die wenigen Jobangebote und Fortbildungsmaßnahmen aus, die er in dieser Zeit von dort bekam. Er sagte, er sei nur einmal an eine junge, scheinbar neu eingestellte Urlaubsvertretung geraten, die ihm von sich aus von Fördermitteln erzählte, auf die er Anspruch habe, und die ihm auch was nutzten. Sie war scheinbar noch nicht von ihrer Umgebung befleckt, sagte er, und mutmaßt weiterhin, dass wohl niemand, der über die Kontakte und die Anlagen verfügt, etwas anderes in dem Feld zu finden, als Vermittler beim Arbeitsamt (bzw. ArGe/”Jobcenter”) bleibe. Ich interpretiere: Wenn ich als Zivilist für nichts tauge, melde ich mich zur Armee, und wenn ich für die Armee grade einen Tick zu gut bin, dann bewerbe ich mich beim Arbeitsamt. Ich sehe Alex schon indigniert die Stirn runzeln…
Um halb Neun erreichte ich die Adresse, wo ich übernachten möchte, und ein dieser Tage bärtiger Kamerad aus den Zeiten bei der eben erwähnten Armee empfing mich sehr herzlich. Wir tranken zwei Flaschen Wein und unterhielten uns über dies und das, wobei seine negative Weltsicht einen nicht unwesentlichen Teil zum Inhalt beisteuerte. Ich kann’s ihm auch nicht verdenken, schließlich ist er seit mehreren Jahren arbeitslos, das frisst am Selbstbild. Er zeigte mir ein Jobangebot, Vollzeitstelle, aber bei “Zoo & Co.” brauche er sich erst gar nicht zu bewerben, weil die ihn schon einmal abgewiesen hätten, wo ich mir denke “Na und?” Eine Standardbewerbung zu versenden kostet nicht wirklich ultimativ viel Mühe, aber mich beschleicht das Gefühl, dass er in dieser Hinsicht schlicht aufgegeben hat. Dass er sein eigenes Ding mit Internetgeschäften machen will, ist natürlich gut, ich hoffe aber inständig, dass sich dieses Projekt letztendlich nicht als auf Sand gebaute Realitätsflucht erweist. Als Laie diagnostiziere ich hier einen manisch-depressiven Zustand, und ich habe eine gute Vorstellung davon, wie so jemand tickt. Ich verspreche jedenfalls, an Arbeit beizusteuern, was ich kann, denn mit dem Englischen hat er es nicht so, und ich bin weit davon entfernt, irgendjemanden hängen zu lassen. Vielleicht sollte ich das mal ganz oben auf der Liste meiner persönlichen Stärken festhalten.
Die Wohnung macht einen ganz ähnlichen Eindruck wie sein Innenleben. Aufgeräumt, ja, wenn auch mit einer Menge Krempel vollgestopft, aber ich meine mehr die Grundvoraussetzungen, die diese Wohnung bietet. Es handelt sich um einen Altbau, dessen widerliche Backsteinarchitektur den Eindruck macht, er stamme aus dem finstersten Industriezeitalter in der späten Kaiserzeit. Die Heizung ist uralt, die Fenster entsprechen keinem Umwelt- oder Energiestandard der vergangenen 30 Jahre. Zum Waschbecken im “Bad” muss ich mich zum Zähneputzen sehr tief herabbeugen oder mich auf die Toilette setzen. Der Boden dieses 0,5 qm kleinen Raums besteht aus Holz, von einem Bodenabfluss keine Spur. Der Geruch der sanitären Anlage zeugt vom Sanierungsbedarf der Rohrleitungen. Und das allerverrückteste: Wenn man duschen oder baden möchte, muss man hierzu in die Küche gehen! Gegenüber der Kochzeile mit Waschmaschine befindet sich ein metallener Deckel von 1×2 Metern, unter dem sich eine Badewanne verbirgt. Und für dieses Loch zahlt man in Stuttgart über 400 Euro Warmmiete. Ich gehe davon aus, dass meine Wohnung in Trier ein paar Quadratmeter weniger hat, aber dafür befindet sich das Haus in einem allgemein viel besseren Zustand.
Um halb zwei war ich dann so müde, dass ich die Augen kaum noch offen halten konnte. Ich nahm daher in einem Schlafsack, der gerade so breit ist, dass ich noch problemlos reinpasse, die linke Hälfte seines Doppelbetts in Beschlag. Mein Gastgeber ging um etwa Drei ins Bett und stand um Acht wieder auf. Bis ich die Augen aufkriegte, war es bereits Zehn.
Ich betrat das Wohnzimmer und hätte wegen des kalten Zigarettenrauchs schon kotzen können. Dann wurde ich empfangen mit der Nachricht, dass in Japan ein kleiner Weltuntergang stattgefunden habe, dass es in Sendai starke Zerstörungen gegeben habe und wegen des Ausfalls eines Kühlsystems in einem Kernreaktor bei Fukushima eine nukleare Katastrophe drohe. Ich sah auf dem Computerbildschirm Szenen von meterhohen Gerölllawinen, die sich durch Ortschaften und über Reisfelder ergießen, Autos, die wie Spielzeug einfach weggespült werden, brennende Häuser, die auf der Welle schwimmen. Nicht ganz Taiyô no Mokushiroku (“Die Apokalypse der Sonne”, ein Anime mit Endzeitthema und sozialem Anspruch), aber nah dran. Das Hanshinbeben in Kobe (1995) hat damals 4500 Menschenleben gekostet. Je nach Vorwarnzeit könnten es diesmal mehr sein, vermutlich aber weniger als in Tokyo anno 1923, das mit über 140.000 Toten kaum zu übertreffen sein dürfte.
Das aktuelle Beben wird mit 8,9 auf der Richterskala angegeben… ach Du meine Güte! Hätte dieses Beben die Insel direkt getroffen, wäre jede Stadt in dem Gebiet in Schutt und Asche versunken. Ich glaube, die Wolkenkratzer in Tokyo halten nur Stärke 8 aus, und das Kantôgebiet, in dem sich die Metropole befindet, beherbergt ein Wirtschaftsvolumen, das dem ganz Frankreichs entspricht – man stelle sich vor, ganz Frankreich würde zerstört. Unglaublich.
Nach 20 Minuten war klar, dass die Faktenlage noch viel zu unsicher ist, um mehr als das Allergröbste zu erfahren, außerdem waren die Webseiten der Nachrichtensender völlig überlastet, was das Betrachten der wenigen verfügbaren Videos schwierig machte. Es wird wohl Tage dauern, bis handfeste Informationen verfügbar sein werden, und bis dahin wird sich die Presse dankbar auf den kritischen Zustand des Atommeilers stürzen. Das verkauft sich wegen Chernobyl (1986) noch besser als eine überspülte Landschaft und eine verwüstete Großstadt, die beide weit weg von hier sind.
Meine Sorge gilt jedenfalls in erster Linie meinen Freunden Kanako und Yui, die an der Universität von Sendai studieren. Den Bekanntschaften im Rest des Landes werde ich ich später schreiben, in Stuttgart verfügte ich ja nicht über japanische Tastaturunterstützung.
Um halb Zwei machte ich mich wieder auf in Richtung Heimat und warf die nicht mehr benötigten Notizen, die ich vor meiner Reise ausgedruckt hatte, in einen Papiermüllbehälter in dem kleinen Hof des Mietshauses. Um Stuttgart herum viel Stau, die Autobahn nach Karlsruhe wird auch vielerorts ausgebessert, zum Teil Stop-and-Go. Die Radiosender hatten kein anderes Thema als das Seebeben vor der japanischen Küste. Quasi nach jedem Lied gab es einen Einschub, in dem darauf hingewiesen wurde und die Moderatoren telefonierten live mit Deutschen in Tokyo und auf Hawaii, wo das andere Ende der Flutwelle gegen 15 Uhr erwartet wurde. Dabei gab es keine neue Lageinformation, und auch die persönliche Sichtweise der Anrufer änderte daran nichts, dass einem das Thema nach zwei Stunden auf den Keks ging. Da wurde viel geredet, aber nur wenig Neues gesagt, und das Neue kam in homöopathischen Dosen.
Noch einmal Stau auf der B14, die streckenweise wegen einer Baustelle nur einspurig ist, die Autobahn in Richtung Zweibrücken dagegen erwies sich als frei. Zuletzt brachte ich den Tank noch auf den Füllstand, den er vor der Fahrt hatte. Die Tankkosten betragen 95 E, zuzüglich weiterer 15 E, die ich später am Abend noch in die Kiste meines Vaters tankte, um ihn für die gefahrenen Kilometer etwas zu entschädigen.
Im Gau musste ich dann den endgültigen Kilometerstand festhalten und stellte bei der gelegenheit ein weiteres Versäumnis fest: Ich hatte den Zettel mit dem Kilometerstand am Start in Stuttgart mit in die Tonne geworfen! Soviel Eselei müsste eigentlich wehtun. Ich rief also den Kameraden in Stuttgart noch einmal an und bat ihn, den Zettel zu bergen und mir die gesuchte Zahl zu übermitteln. Er werde das mangels Handy per Mail tun, versprach er. Dann packte ich nach einer halbstündigen Pause lediglich noch meine Sachen zusammen, nahm von den Großeltern noch dankbar eine kleine Lebensmittelspende entgegen, und machte mich auf den vorletzten Teil des Rückwegs.
Am Tisch des Vaters verspeiste ich dann ein Kilo Fleisch in Form von knusprigen Hähnchenschenkeln, dazu noch ein paar Pommes und etwas Gemüse, bevor ich gerade noch den Zug in Richtung Trier erreichte.
Das nächste Dilemma erwartete mich dort: Ich brauchte nämlich noch einen Fahrschein, und wenn ich mir einen am Automaten gezogen hätte, hätte ich den Zug verpasst. Aber es heißt ja, wenn man aktiv den Fahrbegleiter aufsucht und ihm die Situation schildert, könne man Kulanz erwarten und das Ticket im Zug nachlösen.
Ein junger Mann im Trainingsanzug mit, hihi, “Migrationshintergrund” hatte das gleiche Problem, aber der war bereits da gewesen, als ich am Bahnsteig ankam. Statt eines Schaffners fanden wir jedenfalls erst einmal zwei weibliche Angestellte der “DB Security”, deren Gesprächsinhalte etwa ebenso vulgär rüberkamen, wie die beiden fett waren. BMI deutlich über 30, würde ich schätzen. Ich schilderte also erst mal denen die Lage und sie sagten, damit sei meiner Sorgfaltspflicht in einem solchen Fall genüge getan, allerdings würden sie in Merzig aussteigen. Ich machte mich also lieber auf, den Schaffner selbst zu suchen. War aber keiner da, worauf ich die Auskunft bekam, dass es sein könne, dass ein Schaffner in Merzig zusteige. Auch das passierte nicht. Na, dann war immerhin diese eine Fahrt kostenfrei.
Bis ich dann zuhause war, war es etwa Viertel vor Elf, und ich hatte keinen Nerv, noch lange aufzubleiben. Abgesehen davon stanken meine Klamotten abscheulich und ich wollte sie schnellstmöglich “abstoßen”.
Am folgenden Morgen fand ich dann in der Tat zwei Mails vom Master Sergeant vor. In der ersten schickte er mir ein Einladungsschreiben per PDF, das auf den 9. März datiert war, und in der zweiten eine auf den 11. März datierte Bestätigung meiner Anwesenheit in Oberammergau. Und laut Unterschrift ist er tatsächlich von der Air Force.
Der Kilometerstand liegt mir nun in seiner Gesamtheit vor und ich bin insgesamt 933 Kilometer gefahren, und dazu muss man eigentlich den Weg von Trier nach Gersheim noch addieren, was ja noch weitere 300 sein dürften.
Auch der Antrag für die Fahrtkostenerstattung kam heute mit der Post, und den gilt es noch auszufüllen.
Außerdem fand sich in Post ein mittlerweile zweites Hinweisschreiben der Blieskastler Notarin, dass sie bitte einen Überweisungsnachweis für die Grundschuldtilgung zur Übergabe des Gersheimer Hauses erhalten möge. Ich rief daher gleich den Großvater an, um ihn darauf aufmerksam zu machen. Ja, sagte der, diese Rechnung sei noch gar nicht bezahlt, das Geld müsse er erst einmal auftreiben, weil er in den letzten Wochen so viele hohe Rechnungen erhalten habe (unter anderem erwähnte er 900 Euro für das Auto). Klingt ja toll. Ich gehe also mal davon aus, dass er sich vor der Aktion mit der notariellen Übergabezeremonie nicht darüber informiert hat, was die ganze Sache kosten würde. Am Montag will er also die Notarin besuchen, um ich weiß nicht was zu klären. Vielleicht kann man den Betrag ja stunden. Aber ich hoffe, dass diese Sache nicht noch allzu heiter wird.